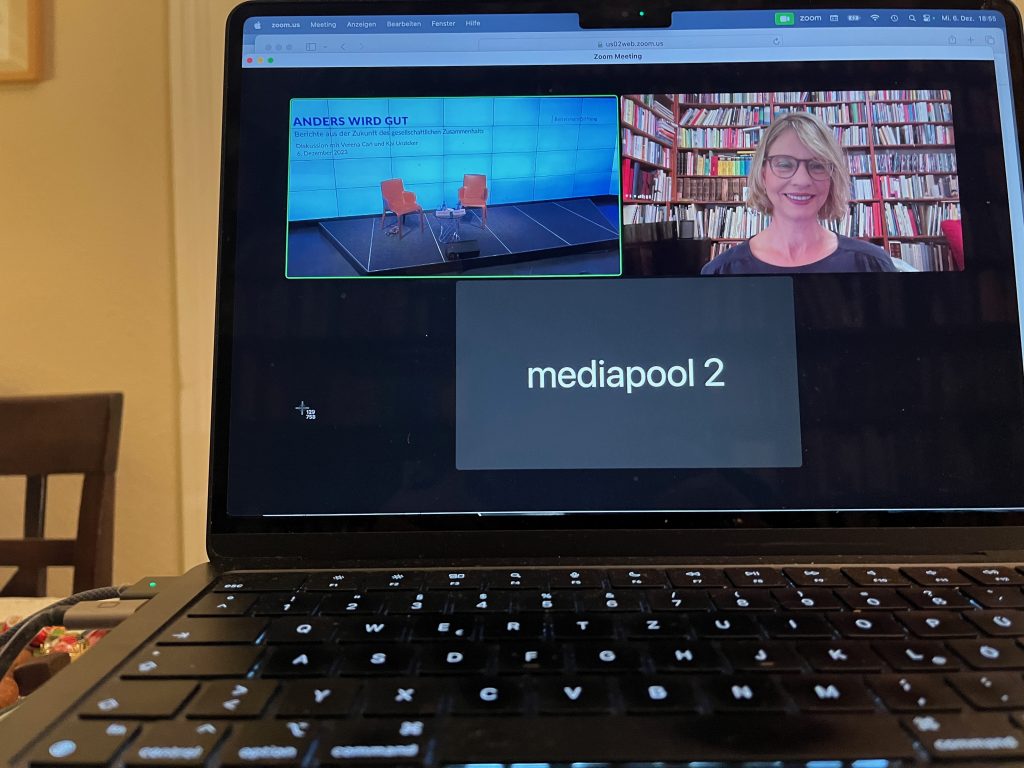Anne Brorhilker ist das prägende Gesicht des Cum-Ex-Skandals, als Staatsanwältin in Köln kämpfte sie engagiert gegen Finanzkriminalität mit vermeintlich weißer Weste. Dann warf sie hin und ging zu einer kleinen NGO – sie findet, dort kann sie mehr bewirken. Eines ihrer ersten Interviews nach dem Wechsel gab sie mir für die BRIGITTE, es erschien im Juli 24
Als Anne Brorhilker 20 war, spielte sie Klavier und Querflöte und wollte Musikerin werden. Oder Musiklehrerin. Aber alle rieten ihr vom Lehramtstudium ab, zu viele Bewerber*innen, zu wenige Jobs. Gut, dann eben Jura, das analytische Denken lag ihr, besonders Strafrecht begeisterte sie. Mit einer Ausnahme: „Ich dachte: Bloß nichts mit Zahlen, mit Wirtschaft.“ Ein frühes Herzensprojekt, das sie prägte, war ihre Arbeit für die „Gnadenstelle“ in Köln. Fälle von Drogenkranken, die wiederholt gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatten, und sie konnte entscheiden: Musste der Staat dort wirklich mit voller Härte durchgreifen, Haftstrafen vollziehen? „Ich habe das gesammelte Elend der Stadt gesehen“, erinnert sie sich.
Aber dann landete sie als Staatsanwältin ausgerechnet im Steuerrecht, Anweisung von oben. Also fuchste sie sich hinein. Und merkte: Da ist ganz eine Art von Täter*innen unterwegs, die ohne Not und kühl kalkuliert den Staat betrügen. „Das hat mein Verfolgungsinteresse erheblich getriggert“, sagt Anne Brorhilker. Sie sitzt auf einem grauen Ecksofa in ihrem Büro, die Ellenbogen lässig auf den Oberschenkeln abgestützt, die Augen wach hinter der schwarz gerahmten Brille. Gerade hat ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen.
Was Anne Brorhilker macht, das macht sie ganz. Von 2011 bis 2023 leitete sie die Ermittlungen im wohl größten Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte, Stichwort: Cum Ex. Banken, Finanzberater*innen und Einzelpersonen hatten sich über Jahre vom Finanzamt Steuern auf Aktiendeals doppelt wiedererstatten lassen, die sie nur einmal gezahlt hatten, verschleiert durch Kreisgeschäfte. 1700 Anklagen erhob die Staatsanwaltschaft, viele Prozesse laufen bis heute, um rund zehn Milliarden Euro soll der Staat so zwischen 2000 und 2020 betrogen worden sein. Der Schaden aus den damit verwandten Cum Cum-Geschäften war mutmaßlich sogar drei Mal so hoch.
Eine Mammutaufgabe – und dass die Chefermittlerin eine Frau war, machte sie nicht kleiner. Noch dazu in der traditionell geprägten Finanzbranche. „Ich bin eher klein, ich bin blond, da wird man umso schneller in eine Schublade gesteckt.“ Bei der Ermittlung in einer Bank schüttelte ein Geschäftsführer allen ihren vier männlichen Kollegen die Hand. Sie, die Vorgesetzte, ignorierte er. „Er hielt mich wahrscheinlich für die Assistentin. Dabei wäre es ja schon ein Gebot der Höflichkeit, auch die zu begrüßen.“ Bald lernte sie, solche Macho-Momente als Hebel zu nutzen. „Wenn Männer merken, dass eine Frau Macht hat, bringt das viele aus dem Konzept.“ Und während die Gegenseite noch mit ihrem Weltbild haderte, konnte Brorhilker schon Anweisungen zur Durchsuchung geben.
Sie ließ sich nicht einschüchtern. Aber da war auch etwas, das zunehmend an ihr nagte. „Mir wurde immer klarer, wie sehr ich in meiner Position auf politische Rückendeckung angewiesen bin. Und die kann keiner garantieren.“ Weil Landesregierungen und Wirtschaftsminister*innen wechseln. Und damit auch die Frage, welche Ressourcen Justiz, Polizei und Steuerfahndung haben. Immer wieder fühlte sie sich ausgebremst. Und so kam es zu einer radikalen Entscheidung: Vor ein paar Monaten hängte sie ihre Robe an den Nagel und ging als Co-Geschäftsführerin zum Berliner Verein „Finanzwende“, rund 30 Mitarbeitende, gegründet 2018 vom ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick. Er und seine Mitstreiter*innen wollen Aufklärung zu Finanzkriminalität leisten, die Justiz gegen die Finanzlobby stärken, politisch Druck machen.
Der Wechsel von Goliath zu David, von der großen Justizbehörde zur kleinen NGO, schlug enorme Wellen. Alle großen Medien berichteten, und die Frau, die immer sehr im Hintergrund geblieben war, auch aufgrund ihrer dienstlichen Verschwiegenheitspflicht, konnte sich freier in der Öffentlichkeit äußern.
Inhaltlich heißt der neue Job für Anne Brorhilker: agieren statt reagieren, nicht mehr hinter Straftätern aufräumen, sondern vor die Welle kommen. Persönlich heißt es: Verzicht auf den Beamtenstatus, Versorgungsansprüche, Altersbezüge. Weniger Gehalt. Warum diese krasse Kehrtwende? „Klar hätte ich auch als Rechtsanwältin zu einer Großkanzlei gehen können und deutlich mehr verdienen“, sagt sie. „Aber das würde meinen Werten widersprechen.“ Die wurden nicht zuletzt vom Elternhaus geprägt, der Vater Wirtschaftswissenschaftler, die Mutter Politikwissenschaftlerin: „Diskussionskultur und ein Gespür für soziale Gerechtigkeit, das habe ich zu Hause am Küchentisch gelernt.“
Ihr neues Arbeitsumfeld: Altbauräume mit knarzenden Dielen statt Behördenflure, im Regal mehr kapitalismuskritische Essays als Aktenordner. Am Tag unseres Gesprächs treffen sich 13 Leute zur Besprechung im Erdgeschoss, hinter dem Schaufenster eines ehemaligen Ladengeschäfts in Schöneberg. Top eins, eine Top-Secret-Recherche, Top zwei, eine geplante Kampagne. Die neuen Kolleg*innen sind eher der Typ: bunter Hoodie, Sneakers, violetter Nagellack. Geschlechtsunabhängig. Anne Brorhilker kommt in marineblauem Blazer und Stiefeletten. Es ist ihr vierter Arbeitstag, der Willkommensstrauß auf dem Schreibtisch noch frisch. Ein Kulturschock? „Nein, viele Arbeitsprozesse sind ähnlich, und auch in der Justizbehörde war ich mit den meisten per Du. Der größte Unterschied: In Behörden arbeiten auch Menschen, die dort einfach eingesetzt werden. Hier sind alle aus Überzeugung, das spürt man.“
Viele Erwartungen sind auf die Neue gerichtet, die Strahlkraft ihres Namens, die Expertise als Juristin. „Anne Brorhilkers berufliche Entscheidung verdient höchsten Respekt und ist eine Kampfansage an Finanzkriminelle und ihre Unterstützer“, so hat es Gründer Gerhard Schick formuliert. Dennoch wirkt es nicht, als wäre sie der Star der Runde. Konzentriert sitzt sie auf einem Eckplatz, wirbelt einen Kugelschreiber zwischen den schmalen Fingern, schreibt in ein blassgrünes Notizbuch. Hört viel zu, stellt präzise Fragen. Sie braucht keine Show, um zu wirken. Auch wenn sie von Teilen der Presse so gelabelt wurde: die egomane Oberstaatsanwältin, die Prozesse auf ihre Person zuschneidet. Was möglicherweise mehr über das Frauenbild der Kritiker*innen sagt als über sie selbst: „Wer führen will, muss auch Führung zeigen. Bei einem Mann wäre dasselbe Verhalten vermutlich als Durchsetzungsstärke gelobt worden“, sagt sie.
Sie glaubt an den Rechtsstaat, trotz allem. Umso mehr ärgert es sie, wenn dieser Staat mit zweierlei Maß misst. „Bei Organisierter Kriminalität greift die Justiz selbstverständlich durch, etwa bei Clankriminalität oder Drogenhandel im großen Stil. Finanzkriminalität gehört in dieselbe Kategorie, und muss auch so behandelt werden.“ Die entgangenen Steuereinnahmen fehlen ja überall, von Kindergrundsicherung bis Klimaschutz. „Das ist sozialschädlich und demokratieschädlich.“ Doch bei der Verfolgung trifft eine zeitlich und personell überlastete Justiz auf smarte und finanzkräftige Gegner. „Bei einer Ermittlung gegen eine Bank standen wir zu fünft etwa 200 Anwält*innen gegenüber, mit Maßanzügen, Doktortitel, goldenen Visitenkarten. So etwas schüchtert ein, das soll es auch“, erzählt Anne Brorhilker.
Doch wenn das so ist, warum blieb der ganz große öffentliche Aufschrei dennoch aus? Sie hat zwei Erklärungen: Zum einen gelte Steuerbetrug vielen als Kavaliersdelikt, die Dimension werde unterschätzt. Zum anderen treibe die Finanzbranche geschickte PR: „Sie hat das Thema erfolgreich mit einer Aura der Komplexität umgeben: Du kleiner Nobody wirst das nie verstehen, überlass das den Expert*innen. Das verhindert unangenehme Fragen.“ Dabei könnte man Cum Ex und Co auch einfacher erklären. Man müsste nur wollen.
Auch bei dieser Art von Aufklärung wird Anne Brorhilker wieder hundert Prozent geben. Der Finanzlobby und der Politik unangenehme Fragen stellen, mit Sachverstand aufmerksam machen, wenn Staat und Behörden bei Sozialbetrug hart durchgreifen und bei Finanzkriminalität bequeme Deals anbieten. Gut für die soziale Gerechtigkeit, für ihre Work-Life-Balance eher nicht. Klavier spielt sie immer noch gern, aber es steht noch in Köln, wo sie mit ihrem Mann lebtDerzeit pendelt sie. Aber immerhin: Nach Konzertterminen in Berlin, da hat sie schon mal Ausschau gehalten.