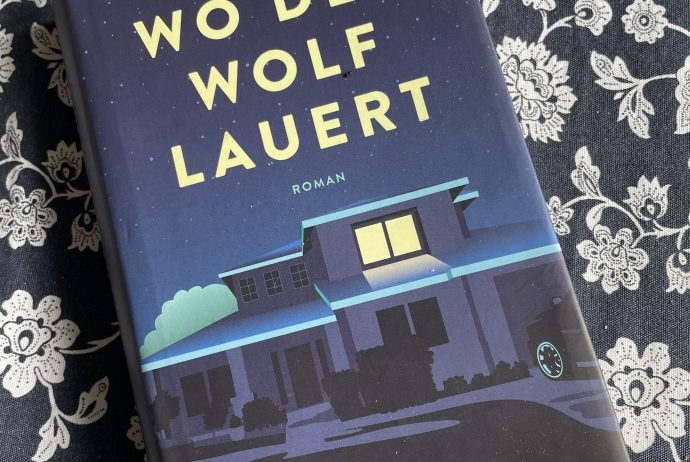Die große Mehrheit aller jungen Eltern findet, ein Vater solle so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern verbringen. Aber die Quote derer, die länger Elternzeit nehmen oder ihre Arbeitszeit dauerhaft reduzieren, spricht eine andere Sprache. Wie kann sich das ändern? Fürs ELTERN-Magazin, Dezember 2022, habe ich mich mit vier Männern unterhalten, die Ernst machen
Treffen sich vier Väter auf Zoom und wollen mal reden. Darüber, wie Kind und Karrieremachen zusammenpassen, wie man Liebe, Abwasch und Jobprojekte zusammenbringt und woran es eigentlich liegt, dass zwischen Müttern und Vätern die Aufgaben immer noch so ungleich verteilt sind. Einer sitzt vor einem an die Wand gehängten Surfboard, einer ein Kellerbüro, zwei haben virtuelle Hintergründe eingeblendet; zwei sind älter, zwei jünger. Aber, kein Witz, eines haben sie alle gemeinsam…
ELTERN FAMILY: Roman, Marius, Harald, Volker: Ihr habt insgesamt zehn Kinder, seid alle verheiratet und angetreten, aktive Väter zu sein. Wie läuft‘s?
Roman: Ich habe nach der Geburt unserer Zwillinge nur zwei Monate Elternzeit genommen, rückblickend würde ich sagen, das war viel zu wenig. Aber ich glaube, am Ende macht nicht die Dauer der Auszeit einen guten Vater aus, sondern vor allem das normale Alltagsleben, das Teilen der Carearbeit, für 18 Jahre oder mehr. Es ist perfekt, ein halbes Jahr zu Hause zu sein, aber nicht, wenn man danach mehr oder weniger abwesend ist.
Wie sieht das konkret bei dir aus?
Roman: Unsere Kinder sind von etwa 8.30 bis 16 Uhr in der Kita, meine Frau und ich teilen uns Erwerbs- und Familienarbeit. Das muss nicht jeden Tag die gleiche Stundenzahl sein, aber am Ende des Monats, des Jahres muss man sich in die Augen schauen können und sagen: Ja, das hat für uns gepasst. Glücklich-glücklich kann gleichbedeutend sein mit Fifty-Fifty, muss aber nicht. Meine Erfahrung ist, je aktiver man als Vater ist, desto schöner wird es, desto mehr vermisst man seine Kinder, wenn man ihnen mal nicht nah ist. Viele Väter, gerade solche in Führungspositionen wie ich, haben das nie erlebt.
Marius: Bei meinem älteren Sohn, jetzt neun, habe ich auch nur die zwei Vätermonate gemacht, ohne groß nachzudenken – das war halt Standard. Später wurde auch ich Papa von Zwillingen, und habe ein ganzes Jahr lang ausgesetzt. Meine Frau ist Ärztin mit eigener Praxis, ich war damals angestellt in einem großen Konzern. Danach bin ich in Teilzeit zurückgegangen, mittlerweile habe ich mich selbständig gemacht und halte außerdem den Laden zu Hause am Laufen. Das heißt, wenn in der Kita ein Kind hinfällt, dann bin ich derjenige, der angerufen wird. Das musste ich denen erst mal beibringen!
Harald: Ich bin hier in der Runde der Hardcore-Elternzeitler: Ingesamt elf Jahre mit einem Pflegekind und später zwei leiblichen Kindern. Das lag aber auch daran, dass mein früherer Arbeitgeber, ein Mittelständler aus dem Technikbereich, mich mit allen Mitteln loswerden wollte. Heute arbeite ich 14 Stunden die Woche als Schreibkraft, was gut in unser Leben passt, aber wenn man ehrlich ist, bin ich formal total überqualifiziert.
Volker, du berätst seit über 15 Jahren Firmen zu Vereinbarkeitsthemen, speziell im Hinblick auf Väter. Welche Erfahrungen bringst du selbst mit?
Volker: Meine Frau und ich haben mit unserer älteren Tochter schon vor 22 Jahren ein Fifty-Fifty-Modell gelebt, das war damals noch viel schwieriger zu organisieren, es gab ja kaum Betreuungsplätze für jüngere Kinder. Auch mir hat mein Arbeitgeber damals für eine Vater-Auszeit die Rote Karte gezeigt – das war der Anstoß für meine Selbständigkeit. Heute haben wir Kunden vom Großkonzern SAP bis zu den Stadtwerken Lübeck, und überall rumort es in den Unternehmen. Auch durch den Homeoffice-Boom während Corona sind gerade jüngere Väter zunehmend nicht mehr bereit, alte Muster weiterzustricken.
Und doch ist der Fortschritt eine Schnecke, und Beispiele wie die euren bleiben die Ausnahme. Woran liegt das: die Wirtschaft, die Männer, die Frauen…?
Marius: Als ich meinem Vorgesetzten gesagt habe, dass ich über ein Jahr pausieren will, wusste ich, dass meine Expertise nicht so schnell zu ersetzen ist und habe das auch so angekündigt – „Chef, jetzt versau ich Ihnen den Tag!“. Er hat es trotzdem cool aufgenommen, da kann ich nicht klagen. Unangenehm waren eher die Spitzen aus der obersten Führungsebene. Die trifft man auf dem Flur, unterhält sich nett, „Mensch, Sie gehen in Elternzeit, freuen Sie sich?“, und im Gehen kommt dann eine Bemerkung wie: „Na, Sie werden schon wissen, was Sie tun“. Da ist noch viel altes Denken in den Köpfen.
Roman: Diese Haltung zieht sich noch immer quer durch die Gesellschaft, bei Männern wie Frauen, im Privaten wie im Beruflichen. Wenn ich Interviews gebe, kommentieren auch manche Frauen online: Aber Kinder gehören doch zur Mutter! Andererseits begreifen auch manche Männer nicht, warum sich überhaupt etwas ändern sollte. Dabei ist für mich eines klar, moderne Unternehmenskulturen brauchen nicht nur Frauen im Vorstand, sondern auch Väter, die für ihre Kinder da sein können.
Gehst du als Chef mit gutem Beispiel voran?
Roman: Ich gehe auf Mitarbeitende zu und sage: Ich hab gehört, du wirst Papa, oder du wirst Mama, wie können wir dich unterstützen? In meinem Führungsteam sind alle Männer in Elternzeit gegangen, auch mehr als zwei Monate. Denn wenn ein Chef, eine Chefin das aktiv angeht und kein Tabu aus Vereinbarkeitsfragen macht, erzählen Männer im Unternehmen früher und offener, dass sie Vater werden. Nach dem dritten Monat, wenn sie es auch ihren Freunden sagen. Das wiederum gibt dem Arbeitgeber fast ein halbes Jahr Puffer, um zu planen.
Harald: Klingt gut, aber ich habe genau das Gegenteil erlebt. Man hat ja als werdender Vater nicht denselben Kündigungsschutz wie eine werdende Mutter, ob es also schlau ist, frühzeitig eine Ankündigung zu machen, hängt also sehr von der Unternehmenskultur ab. Für meinen Vorgesetzen war ich sofort abgeschrieben, als ich gesagt habe, ich möchte aussetzen.
Roman: Aber meiner Meinung nach macht es der derzeitige Fachkräftemangels einfacher, einen neuen Arbeitgeber zu finden, der Vereinbarkeit ermöglicht. Es wäre doch jetzt genau die richtige Zeit für Väter, selbstbewusster aufzutreten!
Harald: Ich habe mich vielfach in Teilzeit beworben, sowohl im Bereich Einkauf und Beschaffung, wo ich vor meiner Elternzeit gearbeitet habe, als auch mit meiner Basisqualifikation als Elektriker und Elektrotechniker. Aber wenn die sehen, da will ein Mann weniger als 30, 40 Wochenstunden arbeiten, kommt innerhalb von drei Tagen eine Absage!
Volker: Es gibt Riesenunterschiede zwischen den Milieus, zwischen Stadt und Land. Zwar nehmen in Bayern die meisten Väter die zwei so genannten Vätermonate, mehr als in allen anderen Bundesländern, aber danach heißt es, vor allen in ländlichen Gebieten: Jetzt bringst du bitte wieder 120 Prozent, für Familie ist deine Frau zuständig. In Metropolregionen mit mehr Fachkräftemangel, mehr Konkurrenz, mehr Vielfalt ist die Situation oft günstiger. Aber es gibt auch eine aktuelle Studie der Antidiskriminierungsstelle, die sagt: Nicht nur jede zweite Frau erfährt im Arbeitsleben Diskriminierung, wenn sie Mutter wird, auch jeder dritte Vater. Bei den Frauen ist es eher die Rückkehr in den Job, bei den Vätern beginnt es bei der Ankündigung, dass sie reduzieren möchten, weil ein Kind kommt. Da ist die Politik gefragt, Rahmenbedingungen zu ändern, das können wir nicht nur im Privaten lösen.
Marius: Bin ich total bei dir. Wir müssen aber aufpassen, nicht in so einen Tenor abzugleiten: Hilfe, Familie, Riesenbelastung! Ich habe total davon profitiert, in der Elternzeit einen Schritt zurückzumachen vom Arbeitsleben, Dinge anders zu denken. Ich habe eine andere Perspektive auf das Leben, einen anderen Fokus. Das bringt mich persönlich weiter, im Berufsleben, in der Paarbeziehung.
Volker: Gutes Stichwort, Paarbeziehung. Entscheidend ist, dass man es schafft, nicht nur Familienarbeit, sondern auch den Mental Load gerecht aufzuteilen: Wer besorgt das Geschenk für die Schwiegermutter oder organisiert den Kindergeburtstag? Da entsteht nämlich schon in der Elternzeit ein Ungleichgewicht, weil das zu wenig besprochen wird. Ich würde mir auch wünschen, dass die neuen, jungen Väter die älteren fragen, Mensch, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Wann habt ihr euch wie aufgeteilt?
Marius: Die haben sich doch solche Gedanken größtenteils gar nicht gemacht!
Harald: Also, ich bin in den Siebzigern, Achtzigern in kleinbäuerlichen Strukturen groß geworden, da hat zu Hause jeder angepackt. Wenn mein Vater im Schichtdienst war, saß meine Mutter auf dem Traktor, und wenn sie beim Arbeiten war, dann hat mein Vater mir das Schulbrot geschmiert. Für mich ein gutes Vorbild. Als ich selbst Vater wurde, habe ich jedenfalls viel positives Feedback bekommen, vom Freundeskreis bis zur Krabbelgruppe.
Marius: Ja, dieses Positive habe ich auch erlebt, aber nicht nur. Es gab auch total absurde Situationen. Etwa, wenn man Bekannte trifft und erzählt, wir haben Zwillinge, da kommt vor allem von älteren Frauen gerne so ein Spruch: „Oh, die arme Mutter.“
Roman (lacht): Ja, hier auch: „Das ist aber anstrengend für Ihre Frau.“
Marius: Dabei freuen wir uns doch darüber, dass wir diese Kinder haben, da ist niemand arm. Zweitens bin ich derjenige, der zu Hause alles wuppt. Drittens, bring dein Weltbild in die Altstofftonne. Aber auch bei Babytreffen gab es solche, die sich keinen Reim auf mich machen konnten. Einmal habe ich zwischen zwei Müttern gesessen, die sich lang und breit über meinen Kopf hinweg über meine Kinder unterhielten, als wäre ich gar nicht da: „Oh, süß, Zwillinge, welches ist wohl das ältere….“ Dabei hätten sie mich nur fragen müssen, sie wussten ja, dass die Kinder zu mir gehören.
Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, das Geld. Es gibt Paare, da können sich weder Mütter noch Väter längere Auszeiten leisten….
Harald: Stimmt, Elternzeit ist Luxus. Wir sind es pragmatisch angegangen: Was gibt unsere Konstellation her, jenseits von Männer- und Frauenrolle? Meine Frau war erst fünf Jahre in ihrem Beruf als Lehrerin und wollte vorankommen, ich bin zehn Jahre älter und hatte dafür mehr Rentenpunkte. Logisch, dass ich zu Hause bleibe.
Marius: Wir haben für meine Elternzeit bei den Zwillingen hart gespart. Wir hätten sie auch früher in die Krippe geben können, aber das wollten wir nicht, weil wir bei unserem Großen nicht so gute Erfahrungen gemacht hatten. Danach was das Geld komplett aufgebraucht, aber das war es uns wert. Mein Punkt ist, in vielen Familien findet dieser Planungsprozess gar nicht statt. Der Mann denkt, er muss die Kohle anschaffen, die Mutter denkt, sie müsste zu Hause bleiben, und damit wird das Thema so weggewischt.
Volker: Wir wissen, dass 77 Prozent der Väter den Löwenanteil des Geldes nach Hause bringen, es sagen aber auch 70 Prozent der Mütter, dass es wichtig für sie ist, in den ersten Jahren Zeit mit dem Kind zu verbringen. Das emotionale steht noch vor dem finanziellen. Und ich gebe Marius recht: Wir haben noch keine gesellschaftlichen Rituale dafür, wie und wo Paare sich darüber austauschen könnten! Väter gehen heute mit zum Geburtsvorbereitungskurs und reden über Ängste vor der Geburt – aber nicht darüber, was danach kommt. Unsere Idee als Beratungsunternehmen ist, Vereinbarkeitscoaches in Firmen zu installieren, die mit werdenden Eltern ins Gespräch kommen, auch wenn einer von beiden gar nicht dort arbeitet. Es braucht eine andere Gesprächs- und Arbeitskultur, quer durch die Branchen – auf dem Bau, in Rechtsanwaltskanzleien, im Gesundheitswesen….
Roman: Ganz wichtig! In der Chirurgie kannst du auch nicht einfach hinwerfen, wenn vor dir einer auf dem Tisch liegt, nur weil die Kita anruft, dass dein Kind Fieber hat. Anders als in anderen Berufen. Es gibt aber schon New Work-Modelle für Gesundheitswesen oder Industrie, mit denen man zum Beispiel per App flexibel Schichten tauschen kann, das hilft sehr. Aus meiner eigenen, früheren Erfahrung als Schichtarbeiter würde ich sagen: Es hat auch Vorteile, wenn ein Vater am Ende des Arbeitstages den Hammer und die Feile fallen lassen kann und seine Kinder abholen, ohne auch für den Rest des Tages immer und überall erreichbar sein zu müssen. Abschalten fällt da sicher leichter als in einem Job wie meinem.
Harald: Ich bin bei vielem ganz bei dir, Roman. Aber wenn du eine Woche Spätschicht hast, eine Frühschicht, danach eine Nachtschicht, musst du trotzdem nachmittags die Betreuung bezahlen, auch wenn du sie nicht nutzt. Wenn mein Kind in die Musikschule gehen will und der Nahverkehr auf dem Land ist ein Debakel, dann ist der halbe Nachmittag mit Fahrdiensten belegt. Vieles klingt in der Theorie besser als in der Praxis.
Zum Schluss ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr seid 70 Jahre alt, eure Kinder erwachsen. Was sollen sie über euch sagen, wenn sie an ihre Kindheit denken?
Volker: Es wäre schön, wenn meine Töchter sagen: Er hatte immer dann Zeit für mich, wenn es wirklich wichtig war.
Marius: Da schließe ich mich an.
Roman: Man muss ja erstmal anwesend sein, um auch zum richtigen Zeitpunkt da zu sein. Meine Kinder sollen sich daran erinnern, dass sich nicht nur das Eis am Wochenende mit ihnen geteilt habe. Sondern auch ihre Probleme und Sorgen.
Harald: So ist es. Ständig gebraucht zu werden, das ist das Schlimmste am Vatersein. Und zugleich auch das Schönste.
Unsere Gesprächspartner:
ROMAN GAIDA, 40, lebt mit seiner Frau und vierjährigen Zwillingssöhnen in Düsseldorf und leitet den Geschäftsbereich CNC in der Niederlassung des Mitsubishi-Konzerns. In seinem aktuellen Buch erzählt er von seinem Weg zwischen Karriere und Vaterschaft und gibt Tipps für Männer, die beides wollen: „Working Dad“, Campus, 24 €
HARALD LÖFFLER, 52, ist mit Frau und drei Kindern (11, 9 und 5) im ländlichen Franken zu Hause. Der ausgebildete Elektrotechniker arbeitet zur Zeit in Teilzeit als Schreibkraft.
MARIUS KRONSBERGER, 41, wohnt mit Frau und Kindern (das ältere neun, die jüngeren Zwillinge vier) als Immobilienmakler an der Ostsee. Seine Erfahrungen aus der einjährigen Elternzeit sind nachzulesen in „Von einem der heimging, um bei seinen Kindern zu sein“ (im Selbstverlag, zu bestellen im Buchhandel, 14,90 €)
VOLKER BAISCH, Unternehmensberater, 55, hat mit seiner Frau zwei erwachsene Töchter und lebt in Hamburg. Seine Firma entwirft Konzepte zu Vereinbarkeitsfragen im Job, besonders im Hinblick auf Väter (conpadres.de)