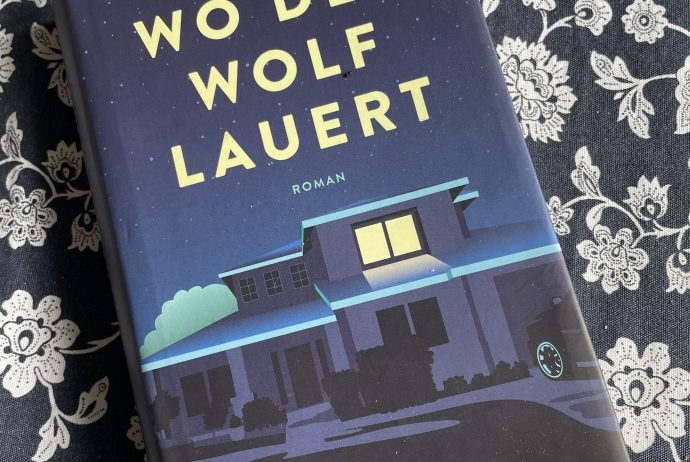Was ist schlimmer für Eltern: Wenn das eigene Kind zum Opfer wird oder zum Täter? Und macht Liebe blind für die Schattenseiten derer, die uns nahe stehen? Die israelische Psychotherapeutin und Schriftstellerin Ayelet Gundar-Goshen stellt unbequeme Fragen – ich durfte sie für ZEIT online interviewen
Alle Eltern kennen die Angst, jemand könnte ihrem Kind etwas antun – von Ausgrenzung in der Schule bis zu Gewaltverbrechen. Für die Hauptfigur Ihres neuen Romans, eine israelische Mutter in Kalifornien, kippt diese Angst ins Gegenteil, als sie sich fragen muss, ob ihr Teenagersohn einen Mitschüler getötet hat. Was hat Sie an diesem Setting gereizt?
Als Autorin und Psychologin habe ich die Möglichkeit, Abgründe auszuloten, vor denen meine Figuren zurückscheuen. Aber auch persönliche Schlüsselmomente haben mich auf das Thema gebracht. Am ersten Kindergartentag meiner kleinen Tochter habe ich mich nervös gefragt: Was tun die anderen Kinder ihr möglicherweise an, wenn ich sie nicht mehr den ganzen Tag beschützen kann? Bis mir klar wurde: Mit mir stehen hier noch 20 andere Mütter, besorgt und mit Herzklopfen, in der Überzeugung, dass ihre eigenen Kinder unschuldige Lämmer sind, die in einen Wald voller Wölfe geschickt werden. Und keine fragt sich: Moment – könnte es sein, dass mein Kind selbst der Wolf ist?
Aber brauchen Kinder nicht auch diesen verklärten Blick, das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden?
Klar. Als Eltern sehen wir unsere Kinder im besten Licht, das ist unser Job. Wir nehmen an, dass niemand sie so lieben kann wie wir, mit Recht. Aber das bedeutet auch, dass wir blind sind für manche ihrer Seiten. Auch, weil es unser Selbstbild stört.
Das Kind als kostbarer Besitz, als Objekt elterlicher Allmachtsphantasien?
Manche präsentieren ihre Kinder wir einen Leistungsnachweis: das Beste, das mir je gelungen ist! Mich macht das misstrauisch. Wenn eine Mutter sagt: „Mein Kind würde nie etwas Böses tun“, dann ist das wichtigste Wort in diesem Satz das Possessivpronomen: „mein“. Etwas, das aus mir entstanden ist, ist über jeden Zweifel erhaben. Dieser Narzissmus bringt ein bestimmtes Selbstverständnis mit sich: ich mache mich zur Anwältin meines Kindes in seiner Auseinandersetzung mit der Welt, unabhängig davon, wer im Recht ist, egal, ob es um Schulnoten geht oder um Konflikte mit anderen Kindern.
Als die Mutter in Ihrem Roman herausfindet, dass ihr Sohn ein Verbrechen begangen haben könnte, will sie es nicht wahrhaben, verdrängt es, hat Angst, ihn zu konfrontieren. Mord ist natürlich ein extremes Beispiel, aber vielleicht verhalten sich die eigenen Kinder aggressiv, verbal oder körperlich. Was wäre Ihr Rat als Psychotherapeutin: Wie können wir mit unseren Kindern ins Gespräch kommen, damit sie lernen, besser mit solchen Impulsen umzugehen?
Mein Rat wäre: Nicht wegsehen, nicht kleinreden, sondern versuchen, die Motivation des Kindes zu verstehen. Verstehen heißt aber nicht akzeptieren. Wir müssen ganz klar machen, dass sein Verhalten falsch war, dass es bessere Wege der Konfliktlösung gibt, sollten aber Kinder nicht für ihr Verhalten bestrafen. Denn Strafe führt nur zu Groll und Wut, und wir möchten ja ein zarteres Gefühl auslösen – Bedauern. Deshalb sollten wir dem Kind vor allem vermitteln: Ich glaube, dass du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Du bist nicht böse, du hast etwas Böses getan, und du kannst es ändern.
Wahrscheinlich kommen viele Eltern gar nicht an diesen Punkt, weil sie so mit ihrer Angst beschäftigt sind, ihr Kind könnte selbst unter anderen leiden. Sie sagen, bei der Recherche für Ihren Roman haben ihnen einige erzählt: Wenn ich mich entscheiden müsste, ob mein Kind gemobbt wird oder andere mobbt, dann lieber zweiteres. Können Sie das nachvollziehen?
Ich hatte diese Diskussion sogar mit meinem eigenen Partner. Wie viele andere Eltern hat er gesagt: Natürlich möchte ich weder das eine noch das andere, aber im Zweifelsfall wünsche ich mir vor allem, dass mein Kind möglichst wenige Narben davonträgt, psychisch wie körperlich. Wenn es aggressiv ist gegen andere, kann ich es dazu bringen, sein Verhalten zu ändern, und es kann bereuen, was es getan hat – aber Opfer bleibt man ein Leben lang.
Ist das vielleicht eine spezifisch israelisch-jüdischen Erfahrung, eine Urangst: Alles, nur nie wieder Opfer sein?
Das dachte ich auch, als ich mich zuerst mit dem Thema beschäftigte. Der Holocaust ist unser kollektives Trauma, die Angst, wie Lämmer zur Schlachtbank geführt zu werden. Ich kann mich gut erinnern, als ich ein kleines Mädchen war und wir im ersten Golfkrieg einen Angriff aus dem Irak befürchteten, dass mein Großvater verbittert sagte: Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal erlebe, wie jüdische Kinder Angst haben müssen vor Gas. Er wäre lieber in den Krieg gezogen und sogar gestorben, als passiv in einem Schutzraum zu sitzen und nichts tun zu können. Aus diesem unerträglichen Gefühl von Hilflosigkeit erwächst eine Art israelische Macho-Mentalität: Lieber jetzt Stärke zeigen und es später bereuen als umgekehrt. Aber auch in anderen Ländern reagierten Eltern ähnlich auf meine Frage nach ihren Kindern, etwa in Deutschland oder der Schweiz. Ich glaube, es hat mit wachsendem Individualismus zu tun. Mit der globalen Feelgood-Diktatur.
Was meinen Sie damit?
Zufriedenheit und Selbstwertgefühl des Einzelnen stehen ganz oben auf der Agenda, über allem anderen, in weiten Teilen der Welt. Googeln Sie mal Artikel zum Thema „Wie stärke ich das Selbstbewusstsein meines Kindes“ und zum Thema „Wie erziehe ich mein Kind zu einem guten Menschen“ – jede Wette, dass sie beim ersten Begriff deutlich mehr finden?
Dabei spricht ja erstmal nicht dagegen, zu sagen: Hauptsache, meinem Kind geht es gut und es ist glücklich.
Vor zwei, drei Generationen noch ging es Eltern weniger um Wohlbefinden als um Moral, um Sinn, ständig beurteilten sie das Benehmen ihres Kindes: Wird aus ihm ein guter Christ, ein guter Kibuzznik, ein guter Kommunist? Natürlich ist es ein Segen, dass diese starren Systeme heute nicht mehr in der Form existieren, dass gesellschaftliche Zwänge und Schuldgefühle uns nicht mehr die Luft abschnüren. Aber manchmal scheint mir, wir haben das Konzept von Schuld komplett über Bord geworfen, und das besorgt mich. Als Konsequenz daraus biegen wir als Eltern die Welt so zurecht, dass unser Kind sich nicht wehtun kann, und übersehen dabei andere.
Macht es das Leben nicht auch aus, dass es nicht immer diese klaren Fronten gibt, hier Täter, da Opfer?
Genau da wird es interessant. Denn wenn wir uns ein neugeborenes Kind anschauen, und zu welcher Grausamkeit Menschen später im Leben fähig sind, dann fragen wir uns doch: Was ist schiefgelaufen auf dem Weg dahin? Niemand wird als Mörder geboren, als Nazi, als Faschist. Wenn wir uns nicht nur fragen, was unserem Kind geschehen könnte, sondern auch, wozu es fähig sein könnte, dass es Potenzial in sich trägt zu Gutem wie zu Bösen, wäre das ein großer erster Schritt, um Gewalt zu verhindern. Persönlich, zwischen Kindern, in der Schule, aber auch Gewalt zwischen Gruppen oder Nationen. Ich weiß noch, wie ich nach der Geburt meiner Tochter ihre winzigen Fingerchen betrachtete, und plötzlich so einen Gedanken hatte: Was wird sie damit alles tun, vielleicht schreiben, vielleicht Klavier spielen – oder den Abzug einer Waffe betätigen?
Aber warum ist es so schwer, sich den eigenen Abgründen zu stellen, und denen unserer Nächsten?
Weil uns die Vorstellung Sicherheit gibt: Das Böse ist irgendwo da draußen, hier drin, von mir und meiner Familie habe ich nichts zu befürchten. Wenn das Böse uns aber von außen bedroht, können wir es auch gemeinsam bekämpfen, können uns dabei auf der richtigen Seite fühlen, stark, wie in einem Thriller auf Netflix. Wenn wir merken, dass diese Sicherheit trügerisch ist, dann wird es dagegen unheimlich. Aber es wäre hilfreich, anzuerkennen: Das Monster ist nicht draußen, jenseits der Burgmauern, nicht hinter der Staatsgrenze, es ist nicht einmal in unserem Gegenüber, sondern in uns selbst. Deshalb ist es auch so wichtig, schon Kindern beizubringen, sich bei Konflikten in den anderen hineinzuversetzen: Wie würdest du dich fühlen, wenn das andere Kind dich ausgelacht oder gehauen hätte?
Heißt es auch, Verantwortung für unsere aggressiven Impulse zu übernehmen?
Verantwortung ist ein wichtiges Stichwort. In der Psychologie neigen wir manchmal dazu, vor lauter Verständnis für den Aggressor seine Taten zu rechtfertigen. Auf einer persönlichen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen. Nehmen wir den ersten Mord der biblischen Geschichte: Kain tötet seinen Bruder Abel, weil er so eifersüchtig ist, dass Gottvater dessen Opfergabe seiner vorgezogen hat…
…und deshalb ist Gott der wahre Schuldige in der Geschichte?
Eben nicht, das wäre zu einfach. Als Therapeutin würde ich zu Kain sagen: Ja, du hast ein Recht dazu, traurig und wütend zu sein, dich zu beklagen, weil Gott deinen Bruder vorzieht – aber das gibt dir noch nicht das Recht, ihn umzubringen. Und die Schuld dafür auf deinen Vater abzuwälzen. Das gilt genau so, wenn argumentiert wird: Oh, Hitler war so eine charismatische Persönlichkeit, klar, dass die Deutschen ihm gefolgt sind, sie konnten nicht anders. Diese Sichtweise ist fatalistisch, dann können wir auch gleich sagen: C’est la vie, das kulturelle Klima ist an allem Übel Schuld, das Bildungssystem, die Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir uns mit unseren eigenen negativen Gefühlen, Wut und Kränkungen auseinandersetzen, verstehen, woher sie kommen. Aber am Ende müssen wir uns an unseren Taten messen lassen.
Als israelische Mutter betrifft Sie unser Gesprächsthema auch ganz existenziell: Auch Ihr Sohn könnte eines Tages vor der Entscheidung stehen, entweder selbst zu töten oder getötet zu werden, in der Armee. Wie gehen Sie damit um?
Mein Sohn ist fünf, mit 18 wird er eingezogen, mir bleiben also nur noch 13 Jahre, in denen ich dazu beitragen kann, dass die Situation in Israel friedlicher wird. Damit sich keiner mehr entscheiden muss, Opfer oder Täter zu sein. Ich war immer sehr politisch engagiert, und Muttersein hat das noch verstärkt. Genauso hat mich meine Tochter noch mehr zur Feministin gemacht, weil ich alles durch diese Brille sehe: In was für eine Welt habe ich mein Mädchen gesetzt? Sie ist jetzt sieben, was kann ich tun, damit sie nicht später an der Uni oder im Arbeitsleben sexuell belästigt wird? Dass wir unsere Kinder als Erweiterung von uns selbst sehen, ist eben nicht nur narzisstisch, es hat auch eine positive Kraft. Man denkt intensiver über den Zustand der Welt nach und gibt sich nicht einfach mit dem Status Quo zufrieden. Im besten Fall dient das nicht nur den eigenen Kindern, sondern allen.
ZUR PERSON: Ayelet Gundar-Goshen, Jahrgang 1982, gehört zu den profiliertesten Stimmen in der jungen israelischen Literatur und gewann zahlreiche Preise. Sie lebt mit ihrer Familie in Tel Aviv, und arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin und Drehbuchautorin als Psychotherapeutin in einer Klinik. Ihr aktueller Roman „Wo der Wolf lauert“ erscheint in deutscher Übersetzung im Verlag Kein & Aber