
„Krieg ist immer ein Backlash für die Sache der Frauen“
Aber ihre Rolle wird auch unterschätzt, sagt die Historikerin Hedwig Richter. Denn Frauen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um das Voranbringen der Demokratie geht – auch in der Ukraine. Für die BRIGITTE habe ich mit ihr gesprochen.
Seit Beginn von Putins Angriffen fühlt man sich oft wie um 100 Jahre zurückversetzt: Auf der einen Seite die männlichen Helden, die in Kiew kämpfen, während Mütter und Kinder verzweifelt fliehen – und in deutschen Talkshows sitzen Generäle. Ein gesellschaftlicher Backlash?
Hedwig Richter: Krieg und Gewalt sind entsetzlich und immer ein Rückschlag für den Feminismus, oft auf allen Seiten. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass wir Freiheit und Gleichheit auf Dauer nicht zurückdrehen werden. Wir sind nicht blind einem Schicksal ausgeliefert, sondern haben vieles selbst in der Hand.
Inwiefern?
Das wird beim Blick auf die Geschlechterordnung deutlich, die sich immer nur mit großen Mühen ändern lässt. Nach dem Ende des Kaiserreichs 1918 bekamen Frauen das Wahlrecht, um das sie Jahrzehnte lang gekämpft hatten plus besseren Zugang zu Bildung und Berufsleben. Das war fortschrittlich. Die Nationalsozialisten sorgten für Rückkehr zu einer martialischen Männlichkeit, Frauen wurden aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Und nachdem sie im Krieg und in der direkten Nachkriegszeit fast alle Aufgaben der Männer selbst übernommen hatten, kamen die fünfziger Jahre mit ihrem Idealbild der Hausfrauenehe. Doch Stück um Stück ist die Offenheit unserer Gesellschaft gewachsen, die Demokratie hat an Stärke gewonnen. Putin greift genau diese Friedensordnung an: Freiheit, Gleichheit, Vielfalt. Und damit wächst auch das Bewusstsein, dass es sich lohnt, diese Werte zu verteidigen.
Notfalls auch gewaltsam? In der Ukraine kämpfen ja auch ein paar Frauen.
Eine Diskussion, die so alt ist wie der Feminismus selbst. Die eine Strömung sagt: Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, also auch zur Waffe greifen wie die Männer. Die andere Strömung argumentiert: Frauen sind, aus welchen Gründen auch immer, die friedlicheren Menschen und brauchen deshalb mehr Macht, um auf unblutige Weise Lösungen zu finden. Ich habe selbst keine einfache Antwort auf diese Frage. Was man aber sagen kann: Frauen waren schon immer ein Motor friedlicher Transformation.
Woran machen Sie das fest?
Studien zeigen an vielen Beispielen: Wenn sich eine Gesellschaft demokratisiert, ist das nachhaltiger und dauerhafter, wenn es aus der Zivilgesellschaft kommt und nicht von einer kleinen Gruppe, die ihre Ziele gewaltsam durchsetzt. Und an friedlichen Übergängen sind immer mehr Frauen beteiligt als an gewaltsamen. Ihre Rolle wird immer unterschätzt, weil sie nicht so heroisch inszeniert und gewaltsam sind. Nehmen Sie die 68er-Bewegung – dominierend sind Bilder der Steine werfenden Männer, während die Frauen wenig glorios gesellschaftliche Veränderungen durchgesetzt haben, mehr Gleichheit, gewaltfreie Erziehung, Selbstbestimmungsrechte. Auch international ist demokratischer Wandel oft weiblich getrieben, etwa in Belarus oder in Afghanistan. Selbst wenn die Lage derzeit furchtbar ist, denke ich, auf Dauer wird sich das nicht unterdrücken lassen.
Was ist mit den Frauen auf der russischen Seite?
Ich bin keine Russlandexpertin. Aber auch hier sehen wir viele Frauen, die an den Protesten beteiligt sind. Autoritäre Regime wie in Syrien, Belarus und jetzt in Russland sind misogyn und homophob. Und sie schlagen mit voller Härte zu, weil sie wissen, dass ihre Stunde geschlagen hat. Weil die Demokratie, Menschenwürde für alle so attraktiv ist, geistig und materiell, hat sie eine große Anziehungskraft auf Bevölkerung in diesen Ländern. Vieles spricht dafür, dass sich diese Lebensweise am Ende durchsetzt. Und das werden wir ganz stark den Frauen zu verdanken haben.
Darf man sich angesichts des ganzen Leidens überhaupt so etwas wie Geschlechterfragen stellen?
Unbedingt! Hier wird deutlich, dass unsere zivilen Reflexe funktionieren, und dass wir unsere Friedenslektion gelernt haben. Frauenrechte und Emanzipation, berühren den Kern demokratischer Werte: Freiheit und Gleichheit.

Mit leeren Händen
Möchte eine Frau ein Baby, kann sie Mittel und Wege finden, auch solo. Für Männer bleibt der Kinderwunsch dagegen unerfüllt, wenn ihre Partnerin nicht will oder kann. Und für Singles wird es ganz schwierig. Für ZEIT online habe ich im März 2022 mit einem Mann gesprochen, der nichts so gerne hätte wie ein Kind
Natürlich weiß Michael, dass es in Deutschland illegal wäre, Frauen dafür zu bezahlen, eine Schwangerschaft für ein Paar auszutragen. Erkundigt hat er sich trotzdem, bei einem Unternehmen in den USA und einem in Osteuropa. Er hat dann schnell wieder davon abgesehen, er will ja nichts Kriminelles, niemandem schaden. Er wünscht sich nur so sehr ein Kind. Aber Michael ist 37 Jahre alt und hat kein Kind. Eines Tages hat er im Streit zu seiner Partnerin gesagt: „Was, wenn ich eines Tages vor dir stünde, mit einem Baby? Wenn ich dich einfach vor vollendete Tatsachen stellen würde?“
Er hat versucht, sich eine Zukunft ohne Nachwuchs vorzustellen, sagt er, „aber da wird es in meinem Kopf zappenduster.“ Malt er sich ein Leben als Vater aus, hat er dagegen Kino im Kopf: Ausflüge, gemeinsam malen, basteln, Fragen beantworten, die Welt erklären. Schöne, helle Bilder, die heil machen könnten, was er mit sich herumträgt: Erinnerungen an eine schwierige Kindheit, mit einer Mutter, die eines Tages ging und einen Vater, der gebrochen zurückblieb. Er wollte es anders machen. Das wusste er schon mit 13.
Trifft man Michael im Park der kleinen Stadt, in deren Nähe er lebt, ist der erste Eindruck: Da kommt ein freundlicher Mann. Nicht groß, nicht breit, eher leise. Die Worte rollen in weichem Dialekt von seinen Lippen. Seine Sätze beginnt er häufig mit „man“ statt mit „ich“ – gerade dann, wenn es im Gespräch emotional wird. Er könnte gut einer von jenen sein, die zur selben Zeit mit einem Baby im Tragetuch zwischen Krokussen und Schneeglöckchen spazieren gehen oder einem Kleinkind auf dem Laufrad hinterhereilen. Die Rolle würde zu ihm passen. Einmal war er sogar ganz nah dran.
„Nachdem ich meine Lebensgefährtin kennengelernt habe, bin ich immer davon ausgegangen, dass wir eines Tages Kinder haben werden. Sie ist der totale Familienmensch, hat ein inniges Verhältnis zu ihren eigenen Eltern, schon eine Mahlzeit allein ist ihr zuwider.“ Als die Pläne für beide mit Mitte 30 schließlich konkreter wurden, so erzählt Michael es heute, war seine Partnerin sich plötzlich nicht mehr so sicher: Was würde eine Schwangerschaft mit ihrem Körper machen, was die Mutterschaft mit ihren beruflichen Plänen? Am Ende rang sie sich dennoch durch – ein wenig wohl auch ihm zuliebe. Er sagt, er wäre bereit gewesen, alles zu übernehmen: den Großteil der Elternzeit, nachts für das Baby aufstehen. Als 35-Jähriger wollte er Ernst machen mit neuen Rollenverteilungen.
Aber dazu kam es nicht. Statt einer Zeit der Hoffnung und Vorfreude war die Schwangerschaft ein Horrortrip. Zu Beginn litt Michaels Partnerin unter extremer Übelkeit, dann, im vierten Schwangerschaftsmonat, kam das Kind tot zur Welt. „Ich habe noch selten im Leben so geweint“, sagt Michael. Das Nachhausekommen aus dem Krankenhaus fühlte sich an wie eine grausame Parodie auf das, was er sich ausgemalt hatte: statt mit einem lebendigen Baby im Arm mit dem toten, kleinen Körper in einer verschlossenen, herzförmigen Spanschachtel, die sie schließlich dem Bestatter übergaben. Übrig blieben nur eine Geburts- und Sterbeurkunde mit dem Namen, den sie sich für den Jungen ausgesucht hatten, ein winziges Mützchen und ein taubes Gefühl.
Für seine Trauer, seinen Schmerz, seine inneren Kämpfe war danach nur wenig Platz, so hat Michael es empfunden. „Ich hatte so sehr versucht, für meine Partnerin da zu sein in dieser schweren Zeit. Alles getragen, alles organisiert, mitgedacht, als sie nicht dazu in der Lage war. Aber als es passiert war, fragte kaum jemand danach, wie es mir geht, die Freunde, die Kollegen. Nur danach, wie sie es verarbeitet. Als beträfe mich das gar nicht.“
Es ist ein Paradox. Um ein Kind zu bekommen, braucht es zwei Personen, wenigstens ihre Keimzellen. Doch sobald es um Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt geht, steht der Frauenkörper im Vordergrund. Naheliegend, denn die Gesundheit der Mutter, ihr Wohlergehen und auch Lebensplanung sind noch immer stärker mit einem Kind verknüpft als bei Männern, biologisch wie sozial, ob es einem gefällt oder nicht. Männer können Frauen nicht zwingen, schwanger zu werden oder es zu bleiben. Dafür können sie sich später leichter der Verantwortung entziehen. Frauen können dagegen zumindest beeinflussen, ob, wann und von wem sie ein Baby bekommen. Wenn sie Single sind oder in einer lesbischen Beziehung leben und einen unerfüllten Kinderwunsch haben, können sie die Hilfe einer entsprechenden Klinik in Anspruch nehmen. Männer haben diese Option nicht.
Die größere Ferne zwischen Vater und Kind schlägt sich sogar in der Statistik nieder. Während man recht genau weiß, ob eine Frau Kinder hat und wie viele, sind Erhebungen wie der amtliche Mikrozensus für Männer nur bedingt aussagekräftig. Erhoben wird zwar die Anzahl von minderjährigen Kindern pro Haushalt, nicht aber die familiäre Verbindung zu den Erwachsenen. So fallen Väter durchs Raster, die von ihren Kindern und der Mutter getrennt leben, und Väter, deren Vaterschaft beim Kind nicht eingetragen wurde. Das Berliner Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) geht davon aus, dass etwa jeder fünfte Mann in seinem Leben nicht Vater wird.
Was man genauer kennt, ist die Gefühlslage von Männern, die unfreiwillig kinderlos sind. Sie hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Der einsame Wolf ist out, der Neue Mann trägt Baby. Eine Studie des Bundesfamilienministeriums, für die zweimal im Abstand von sieben Jahren kinderlose Männer zwischen 20 und 50 befragt wurden, zeigt: 2013 war ein Viertel unfreiwillig ohne Nachwuchs, 2020 ein Drittel. Der Aussage „Kein Kind zu haben, gilt in unserer Gesellschaft als Makel“ stimmten 2020 fast doppelt so viele Befragte zu wie zuvor (39 gegenüber 20 Prozent). Elternschaft prägt inzwischen nicht nur die Identität von Frauen, sondern zunehmend auch von Männern. „Vatersein gehört zum Mannsein dazu“, fanden 2013 50 Prozent der kinderlosen Männer, sieben Jahre später waren es 56 Prozent.
Bleibt der Nachwuchs aus, kann das bei Männern eine ähnliche Sinnkrise auslösen wie bei Frauen, sagen Ärztinnen und Berater, die Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch helfen. Männer fühlten sich sogar besonders hilflos und litten noch stärker unter der aufgezwungenen Passivität, weil sie sonst gewohnt seien, die Macher zu sein. Zudem fänden Männer zu wenig Ventile für ihren eigenen Kummer.
So ging es auch Michael. Vor allem, als ihm vergangenes Jahr, wenige Monate nach dem traurigen Ausgang der Schwangerschaft, klar wurde: Das war mehr als ein einmaliger Schicksalsschlag. „Ich saß im Homeoffice, meine Lebensgefährtin auch, und ständig habe ich mit angehört, wie sie zu Kollegen am Telefon sagte: Das war so furchtbar für mich, das will ich nie wieder erleben.“ Michael verzweifelte. „Ich habe irgendwann sogar angefangen, Männer im Bekanntenkreis zu beneiden, die fanden, man habe ihnen ein Kind angehängt. Die bekommen etwas geschenkt, das sie gar nicht wollten, – und ich kann nichts tun, um mir diesen Wunsch zu erfüllen.“
Es war auch der Anfang vom Ende der Partnerschaft. Michael sagt, er habe seine Partnerin stützen, auffangen, ermutigen wollen, aber eben auch selbst eine Perspektive gebraucht. Sie hingegen habe jeden Vorschlag für eine weitere Familienplanung als Druck empfunden, nicht nur die abwegige Idee von der Leihmutterschaft. „Sie hat mir vorgeworfen, es ginge mir gar nicht um sie. Sie fühlte sich von mir behandelt, als wäre ihr Körper eine Maschine, die nur repariert werden muss, um bereit zu sein für die nächste Schwangerschaft.“ Hat er niemals überlegt, seiner Partnerin zuliebe die eigenen Lebensziele zu überdenken? „Ja, aber es führte nirgends hin”, sagt Michael. Er ist nicht religiös, ein naturwissenschaftlich denkender Techniker, aber trotzdem fand er auf einmal die Vorstellung von Seelenwanderung plausibel. Vielleicht würde sich sein Kind einen anderen Körper suchen. Neu anfangen. Zurückkommen.
Die Geschichte von Michael und seiner Partnerin hat kein Happy End, vielleicht noch nicht einmal ein Ende, allenfalls ein vorläufiges. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen haben die Beziehung zerstört, im Streit ist die Liebe auf der Strecke geblieben. „Ich habe den Eindruck, es gibt dabei nur Verlierer. Sie ist traurig, ich bin traurig. Ich frage mich: Habe ich sie im Stich gelassen? Sie mich? Wir uns gegenseitig?“ Einfach loszuziehen und sich eine andere Partnerin zu suchen, wie es ihm manche leichthin raten, ist für Michael keine Option. Eine gemeinsame Geschichte wische man nicht einfach so weg.
Der unfreiwillig Kinderlose ist heute 37. Er könnte sich also mit seinem Kinderwunsch noch Zeit lassen, jedenfalls mehr als eine Frau im gleichen Alter. Noch so eine Unwucht zwischen den Geschlechtern. Aber die Biologie ist das eine, die Psyche das andere. Michael tröstet der Gedanke wenig, dass er vielleicht noch in zwanzig Jahren zeugungsfähig ist. „Selbst wenn ich von heute auf morgen jemanden kennenlernen würde – das dauert ja, bis man sich einig ist, ob man wirklich ein Kind haben will. Und was sollte ich mit einer 25-Jährigen, die völlig andere Interessen und Lebensvorstellungen hat?“
Seine Psychotherapeutin hat ihm geraten, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihm schon früher Freude bereitet haben. Damit er nicht in ein so tiefes Loch falle. Jetzt, wo der Frühling kommt, ist er viel draußen in der Natur, und zu Hause hat er sich eine Ecke für Modellbau eingerichtet. Dort bemalt er kleine Spielfiguren, grundiert sie, verziert sie mit feinen Pinseln. Er hat kein Kind, dem er zeigen könnte, wie das geht. Nur das Kind in ihm darf wieder einmal spielen. Das muss fürs erste reichen.
Sei kein Held
Bis zum 24. Februar 22 habe ich in einer Welt gelebt, in der Jungen weinen dürfen und pinke Tüllröcke tragen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist das militärische Denken zurück, und als Mutter eines Sohnes frage ich mich: Kann Feigheit uns retten? Darüber habe ich für das Sinn-Ressort der ZEIT einen Text geschrieben, der in leichter redaktioneller Bearbeitung erschienen ist wie unten
Nun überschlagen sich die Ereignisse, dort wie hier. Wie ein Schneeball, der auf dem Weg den Hang hinab Fahrt aufnimmt, Volumen gewinnt und schließlich alles überrollt. In Kiew und Charkiw sind es die Menschen, ihr Leben, ihre Freiheitsrechte, die davon erstickt werden. In Berlin und Hamburg ersticken wir nur die Zweifel, das Unbehagen, die Widerrede. Von einem Tag auf den anderen befürworten wir mehrheitlich Milliardenpakete für die Bundeswehr, Waffenlieferungen, Unterstützung. Wir fühlen uns auf der richtigen, der gerechten Seite, und die Angst legt mir ihre kalten Finger in den Nacken. Was wird das für meinen Sohn bedeuten, nicht heute, aber vielleicht eines Tages, wenn das nur der Anfang einer neuen, unkontrollierbaren Kriegszeit ist? Was wäre schlimmer, demokratische Werte zu verlieren, Freiheit, Wohlstand – oder ein Kind? Was ist ein Leben wert?
Darüber denke ich nach, eine Woche nach Putins Überfall, und schäme mich dafür. Ukrainische Eltern würde mit Handkuss meine theoretischen Überlegungen gegen ihre konkrete Angst tauschen. In Deutschland sitzen wir warm und trocken. Keiner, der uns auffordert, Molotowcocktails zu bauen und Schützengräben auszuheben. Dort kämpft nicht nur die Armee, auch männliche Zivilisten zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nicht mehr das Land verlassen, weil sie zur Verteidigung gebraucht werden. Ich kann verstehen, was sie treibt, ich bewundere ihren Mut. Und frage mich gleichzeitig: Hätte ich ein Sohn in Kiew oder Charkiw, würde ich ihm raten, sich einem übermächtigen Angreifer entgegenzustellen? Oder sagen: Renn weg, versteck dich, rette dich? Ich kann auf alles verzichten, Wohlstand, Freiheit, aber nicht auf dich?
Mein Junge ist bald 14. Drei Jahre nach seiner Geburt hat Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt und die Bundeswehr zur reinen Berufsarmee umgestaltet. Das war für mich ein Signal: Ob jemand bereit ist, den Kopf hinzuhalten, sich in Lebensgefahr zu begeben, auch bereit sein, zu töten, das ist von nun an eine kühle Entscheidung. Keine staatsbürgerliche Pflicht mehr, der man sich nur aus Gründen der individuellen Moral entziehen kann. Doch nach dem Angriff auf die Ukraine hat es nur etwas mehr als 48 Stunden gedauert, bis die ersten Forderungen kamen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Jedenfalls in Form einer allgemeinen Dienstpflicht, die auch zivile Bereiche umfasst. Fürsprecher sitzen nicht nur im Reservistenverband, auch der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann gehört dazu und der SPD-Sicherheitsexperte Wolfgang Hellmich. Drei Tage nach Kriegsbeginn fragte sich gar der Historiker Karl Schlögel im Talk bei Anne Will, warum junge Europäer nicht freiwillig an der Seite der Ukraine in den Kampf ziehen wie einst Hemingway in den Spanischen Bürgerkrieg.
Wenn ich das höre, denke ich an meinen Sohn, wie er einen Volleyballaufschlag macht, Eintopf aus seinem „Herr der Ringe“-Kochbuch zubereitet, seinen Fischen im Aquarium Namen gibt, und mir wird schlecht. Er gehört zu einer Generation, die von der Krippe an gelernt hat, dass man Streit mit Worten regelt, nicht schlägt, nicht beißt, nicht haut. In der Jungen weinen dürfen, zärtlich sein und sogar pinke Tüllröcke anziehen. Gegner existieren nur auf dem Sportplatz, nach dem Match gibt man sich High Five. Sollen wir sie nun mit den Kindheitsidealen ihrer Großväter anfüttern, der Todesverachtung, der Tapferkeit, nur, weil es einer gerechten Sache dient? Ist nicht es nicht gerade dieses Männerbild, das in seiner extremen Form Wladimir Putin verkörpert, hart, herzlos, homophob? Wenn wir wieder militärisch denken, verlieren wir dann nicht zu viel von dem, was uns ausmacht – und geben damit denen recht, die alte Heldenbilder nicht vom Sockel stoßen, sondern als neue Rollenvorbilder aufstellen wollen?
In meiner Familie ist oft die Geschichte erzählt worden, wie meine Großmutter ihren Sohn davon abgehalten hat, den Helden zu spielen. Im Frühjahr 45 kam er eines Tages von der Schule nach Hause und erzählte, sie hätten mit der Panzerfaust geübt. Sie verließ mit ihm Hals über Kopf den Ort, damit er nicht aus dem Klassenzimmer heraus rekrutiert wurde. Sie stand auf der richtigen Seite der Geschichte, und sie wusste es. Der 15jährige, mein späterer Onkel, hätte für ein mörderisches Regime sterben können, das schon verloren hatte, dabei andere verletzen oder töten. Die Definition von Sinnlosigkeit. Der innere Widerspruch ist mir klar: Für ihn hat sie sich stark gemacht, für die Schwächeren nicht. Keine jüdische Familie versteckt, sich und ihre Nächsten nicht für andere in Gefahr gebracht. Warum sie nicht im Widerstand war, habe ich sie einmal gefragt. Was glaubst denn du?, hat sie gesagt, ich hatte drei Kinder. Das war vielleicht nur die halbe Wahrheit, aber wer wäre ich, ihr das vorzuwerfen?
Alternativloser Pazifismus ist schön, bequem, aber auch denkfaul. An diesem Widerspruch arbeite ich mich ab. Ich will, dass meine Kinder frei wählen, frei lieben, frei denken dürfen, und ertrage gleichzeitig den Gedanken nicht, eines von beiden könnte sich dafür opfern. Dann wieder überlege ich: Was, wenn wir alle empfindsame Weicheier wären, weltweit? Wäre das nicht auf Dauer hilfreicher als eine neue Spirale von Verteidigungsbereitschaft, Gewalt, Eskalation? Es berührt mich, wenn russische Bekannte sich beschämt äußern über ihre autokratische Regierung. Wenn ich vom Komitee der Soldatenmütter in Moskau lese, einer Menschenrechtsorganisation, die sich bereits seit dem Afghanistan-Krieg vor 40 Jahren um Missstände in der russischen Armee kümmert. Eltern wenden sich an sie, die ihre Söhne vor der Einberufung schützen wollen. Die Vorsitzende Valentina Melnikowa hat am sechsten Tag des Ukrainekrieges eine Feuerpause gefordert, damit es zumindest einen Austausch von Toten und Gefangenen geben kann. „We share the same biology, regardless of ideology“, sang Sting 1984, in seinem Song „Russians“ – biologisch sind wir gleich, auch wenn wir unterschiedlich denken. Das war im Kalten Krieg, zu meiner eigenen Teenagerzeit. Wir sind alle auf gleiche Weise verletzlich und hängen an unserem kurzen und unbedeutenden Leben. Das zu wissen, könnte ein Anfang sein.
Entgiftet euch!
Von der missglückten Kurzliebe bis zum Nicht-ganz-so-Traumjob: vieles, was früher „blöd gelaufen“ hieß, heißt heute „toxisch“. In der BRIGITTE-Rubrik „Geht das nur mir so“ habe ich mich Anfang Februar 2022 über den steilen Aufstieg eines giftigen Wörtchens gewundert, das nur selten wirklich passt
Es gibt Begriffe, die kommen aus der Nische und machen innerhalb kürzester Zeit Karriere. Zum Beispiel vom Teenagersprech zum Business-Slang. Da schmettert dann ein Vertriebler dem anderen bei der Präsentation der Quartalszahlen ein launiges „Läuft bei dir!“ entgegen. Das finden Teenager natürlich voll cringe und canceln den Ausdruck, sprich: Sie sagen das dann nie wieder. Es geht aber auch anders herum. Auch wenn Jugendliche mit Wörtern um sich schmeißen, die man bislang eher aus dem Psycho- und Therapiekontext kannte, weiß man, dass sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Etwa, wenn ich mich bei meiner Tochter, 16, nach dem Beziehungsstatus ihrer besten Freundin erkundige und erfahre, dass es schon wieder aus ist mit der Flamme von neulich: „Das war nix, der war toxisch.“
Das ist auf den ersten Blick ganz lustig, weil es eine Drei-Wochen-Romanze verbal zu einem Lars-von-Trier-Trauerstück hochjazzt. Wahrscheinlich konnten sich die beiden Lovebirds einfach nicht auf die richtige Playlist einigen, eine*r hat siebzehn Minuten lang nicht auf eine WhatsApp des anderen reagiert oder sein neues TikTok nicht genügend geliked. Aber als ich meine Tochter so lässig dieses Wort benutzen hörte, das ich bisher eher aus Gesprächen über langjährige Ehen kannte, dachte ich auch: Irgendwas läuft hier falsch, vong Sprache her. Kurzzeitliebe, missglückt? Toxisch! Der neue Job, der sich als unerwartet stressig, unbefriedigend, schlecht bezahlt entpuppt? Toxisch! Genau so wie die anstrengende Freundin, die zu leicht ein Wort in den falschen Hals bekommt, der stoffelige Chef, die übergriffige Schwiegermutter.
Ich will gar nicht bestreiten, dass es Umstände und Beziehungen gibt, die im wahrsten Sinn des trendigen Wortes das Leben vergiften können, lähmen, Magenschmerzen bereiten. Spätestens, wenn seelische Grausamkeit im Spiel ist oder gar körperliche Gewalt. Wenn der Begriff irgendwo passt, dann da. Ich habe auch nichts gegen Anglizismen. Dem Wörtchen toxisch hört man seine schleichende Übernahme aus dem amerikanischen Englisch ja nicht einmal an, weil’s im Deutschen dasselbe Fremdwort gibt. Ich fände es nur besser, wenn man es nicht so inflationär gebrauchen würde.
Denn zum einen tut ein wenig Detox immer auch der Sprache gut. Zum anderen ist es, wenn man’s genau nimmt, ein ganz schön harter Vorwurf, der da so nebenbei formuliert wird: Du Täter, ich Opfer. Du Giftspritze, ich hilflos vergiftet. Dabei gibt es in den allermeisten Beziehungen mehr Grautöne als Schwarzweiß, egal ob privat oder nicht. Wenn eine Liebe scheitert (ich meine nicht die Drei-Wochen-Teenagerknutscherei), liegt das möglicherweise eher an fehlender Kommunikation, ungestillten Sehnsüchten, unterschiedlichen Lebensvorstellungen, als daran, dass eine Seite der anderen über Jahre heimtückisch den Giftzahn in den Hals gerammt hat. Und beim Streit mit Kollegen vorschnell die Karte „toxische Männlichkeit“ zu ziehen, ist ungefähr so differenziert, wie wenn die Kollegen Konflikte mit weiblichen Team-Mitgliedern reflexhaft auf deren Menstruationszyklus schieben („Die hat doch bloß PMS.“) Außerdem ist es unfair denen gegenüber, die tatsächlich in einem Arbeitsumfeld tätig sind, in dem es zugeht wie bei Mad Men 1965. Oder in der „Bild“-Redaktion 2021 unter Julian Reichelt. Die haben nämlich wirklich Grund, sich über eine toxische Atmosphäre zu beklagen.
Alle anderen, die ihrem Gegenüber vorschnell das Label „toxisch“ auf die Stirn kleben, machen es sich also ganz schön einfach, und ziehen sich gleichzeitig aus der Verantwortung: „Ich bin nur das Opfer der Umstände!“ Uncooler Move. Oder, wie mein Dreizehnjähriger neuerdings ständig sagt: echt ranzig. Bleibt nur eine Hoffnung: dass die steile Karriere des Wortes „toxisch“ nicht allzu lange währt. Schließlich sagt auch niemand mehr oberaffentittengeil, etwa seit 1987. Besser ist das.
„Vergeben bedeutet, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen“
Selten mussten wir mehr einstecken als im letzten Jahr. Das Virus hat Familien, Freunde und Paare vor riesige Herausforderungen gestellt und Gräben aufgerissen. Wenn wir die wieder zuschütten wollen, müssen wir verzeihen. Aber das passiert nicht einfach, sondern es ist eine Entscheidung – ein Essay aus der BRIGITTE, Heft 1/22
Als ich sie das letzte Mal zusammen sah, vor etwas über einem Jahr, da wirkten sie ziemlich zufrieden und erstaunlich aufgekratzt. Dabei hatte ich sie insgeheim immer ein wenig spießig gefunden: früh geheiratet, nie weggezogen vom eigenen Geburtsort, jung Eltern geworden. Jetzt waren sie Mitte 40, und es sah aus, als würden sie im demnächst leeren Nest nochmal so richtig aufdrehen. Reisepläne für die Zeit nach Corona standen im Raum, sogar ein Umzug. Aber während meine frühere Kollegin Katja sich auf den neuen Lebensabschnitt freute, hatte ihr Mann Philipp schon mit einem befreundeten Anwalt durchkalkuliert, ob er sich eine Trennung leisten konnte. Nicht, dass er ihr davon erzählt hätte – die säuberlich gefaltete Kostenaufstellung fand sie zufällig in seiner Hosentasche, ehe sie seine Jeans in die Wäschetrommel steckte.
Kürzlich traf ich Katja wieder. Philipp lebte jetzt mit einer anderen Frau zusammen, und seinen Wunsch, man könnte doch trotzdem gelegentlich mal telefonieren oder ins Kino gehen, lehnte Katja ab. Trotzdem wirkte sie nicht voller Groll. „Ich kann und will nicht mit einem Mann befreundet sein, mit dem ich fast 20 Jahre verheiratet war“, sagte sie. „Das heißt aber nicht, dass ich ihm nicht verzeihen kann.“
„Wir werden einander viel verzeihen müssen“ – das lässig hingeworfene Bonmot unseres Ex-Gesundheitsministers von 2020 ist aktueller denn je, in vielerlei Hinsicht. Auch wenn die Scheidungs-Statistiken noch kein klares Bild ergeben, erleben viele im Privaten, wie das Dauerkrisengefühl Beziehungen brüchig macht, gnadenlos Schwachstellen aufzeigt. Und auch sonst sind krasse Fronten entstanden, teils quer durch Freundeskreise, Familien, Arbeitsteams. Wo Shitstorms sich im Stundentakt abwechseln und die verbalen Waffen gefährlich locker sitzen, stehen viele vor der Frage: Wie machen wir Frieden, mit Einzelnen, die uns enttäuscht haben, mit der Politik, mit Andersdenkenden in der Impf-Frage? Und natürlich können uns auch ganz ohne Pandemie alter Groll und unverheilte Wunden zusetzen.
Die Kunst, Verletzungen zu verarbeiten und hinter sich zu lassen, lernt man nicht von selbst. Aber sie wächst mit der Lebenserfahrung, glaubt die „Spiegel“-Journalistin und Autorin Susanne Beyer. In ihrem aktuellen Buch* über eine neue, selbstbewusste Frauengeneration ab Anfang 40 hat sie ein ganzes Kapitel der „Kunst der Vergebung“ gewidmet. Und das Thema liegt wie eine Hintergrundmusik unter vielen ihrer Frauenporträts. „Es war für mich ein Aha-Erlebnis, zu sehen: Verzeihen können, verzeihen wollen, das verbindet viele Menschen, die sich als glücklich bezeichnen. Es geht um eine Lebenshaltung: Ein zufriedenes Leben zu führen, ist nicht nur ein Geschenk, auch eine bewusste Entscheidung“, sagt Susanne Beyer. Das klingt philosophisch, aber schon in Alltagsgesprächen merkt man meist schnell, zu welchem Team jemand gehört, Team „Verzeihung“ oder Team „Rache“: Ist er oder sie einer von denen, die nie zufrieden sind und immer sofort einen Schuldigen dafür benennen können? Die narzisstische Mutter oder den toxischen Ex fürs mangelnde Selbstbewusstsein, den Turbokapitalismus oder die fiese Chefin für die stockende Karriere? Oder kann er oder sie schlechte Erfahrungen ohne Bitterkeit hinter sich lassen, Tiefschläge als Lektion sehen und sich eher als Gestalter*in denn als Opfer betrachten – auch, wenn die Welt es nicht immer gut meint?
Beim Verzeihen geht es nicht um übermenschliche Milde oder gar Konfliktscheu. Sondern um einen souveränen Akt der Großzügigkeit. Ein Geschenk, das wir uns selbst machen können. „Verzeihen erweitert die Selbstbehauptung“, sagt Susanne Beyer, „es bedeutet: Der andere hat keine Macht mehr über mich.“ Eine Längsschnittstudie der Virginia Commonwealth und der Harvard Universität von 2020 belegt eindrucksvoll die wohltuende Wirkung auf Körper und Seele. Dabei wurden Antworten auf Fragen nach dem psychischen Befinden und Gesundheitsdaten von über 50.000 Befragten über 30 Jahre darauf hin untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Groll und Gesundheitsproblemen. Die Studie ergab eindeutig, dass Menschen mit höherer Bereitschaft zu Verzeihen seltener unter Depressionen und Angststörungen litten und sich insgesamt besser fühlten. Und ein anderer Datenabgleich, durchgeführt von einem südkoreanisch-amerikanischen Forschungsteam, legt sogar einen Zusammenhang nah zwischen unverarbeiteten Kränkungen und Autoimmunkrankheiten, Bluthochdruck und anderen weit verbreiteten Diagnosen. Dem folgt ein Therapieansatz, der vor einigen Jahren in den USA aufkam. In der „forgiveness therapy“ – also der „Vergebungs-Therapie“- lernen Opfer traumatischer Erfahrungen, anders mit ihrer Geschichte umzugehen.
Klingt nach einer Lektion, die es sich zu lernen lohnt – auch wenn es nicht leicht fällt. Denn es geht ja nicht um ein lässiges „Schwamm drüber“, nicht um vergessen und verdrängen. Im Gegenteil, sagt Melanie Wolfers, Autorin, Theologin und Philosophin, die in den letzten Jahren bereits mehrere Bücher zum Thema geschrieben hat*: Wer wirklich verzeihen lernen möchte, gerade da, wo’s ans Eingemachte geht, muss erstmal zurück auf Los, dahin, wo es wehtut. „Im Schlamassel ankommen, die eigenen Gefühle erkennen und benennen: Scham, Angst, Ohnmacht, Wut. Eine Sprache dafür finden, etwa, indem man die Empfindungen aufschreibt oder mit Unbeteiligten darüber spricht“, das ist für Wolfers der erste Schritt. Der zweite ergibt sich daraus: Durch die Selbstreflexion einen Schritt von der eigenen Betroffenheit zurücktreten, Gefühle anders einordnen, schließlich der Perspektivwechsel. Warum hat die Gegenseite sich so verhalten, was war vielleicht mein eigener Anteil daran, etwa beim Ende einer Liebesbeziehung? Am Ende der bewusste Entschluss: Ich möchte die Sache hinter mir lassen. „Vergeben bedeutet, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen“, bringt Melanie Wolfers das paradoxe Wesen der Unversöhnlichkeit auf den Punkt. „Denn wer nachträgt, trägt schwer.“ Stattdessen geht es darum, die eigene Geschichte anders weiterzuschreiben. Und dadurch inneren Frieden zu finden.
Klar, das klappt nicht immer mit derselben Geschwindigkeit – eine verletzende Bemerkung im Netz lässt sich vielleicht in ein paar Stunden verarbeiten, um über den Vertrauensbruch eines langjährigen Lebenspartners hinweg zu kommen, kann es Monate oder sogar Jahre brauchen. Aber im Prinzip gilt die heilsame Reiseroute für alle Konflikte. Sogar, wenn die Vorwürfe nicht anderen gelten, sondern wir uns selbst mit Schuldgefühlen martern. Uns übelnehmen, dass wir unsere Kinder in Homeschoolingzeiten zu oft angeschrien haben, zu wenig Zivilcourage gezeigt, uns zum Horst gemacht haben vor anderen. „Viele Menschen sind emotional wohlwollender mit anderen als mit sich selbst“, hat Melanie Wolfers festgestellt. „Wenn ich mir selbst verzeihe, akzeptiere ich mich damit als unperfekten Menschen.“
Sich selbst und anderen zu vergeben, ist eine Sache – Versöhnung eine ganz andere. Und das eine zieht das andere nicht automatisch nach sich, als wären wir in einer Ausgabe der Neunziger-Spielshow „Verzeih mir!“ Manchmal, weil es gar nicht möglich ist – etwa, weil die alte Wut einem bereits verstorbenen Elternteil gilt – , manchmal, weil sich äußere Wege längst getrennt haben, etwa nach einer gescheiterten Liebe. „Es kann auch stimmig sein, den Kontakt zu einer Person abzubrechen, von der ich mich verletzt fühle“, sagt Melanie Wolfers. „Entscheidend ist, dass ich mich innerlich nicht im Groll gegen sie verbeiße.“ Verzeihung ohne Versöhnung ist also durchaus möglich – nicht aber Versöhnung ohne die grundsätzliche Bereitschaft, zu verzeihen. Unabhängig davon, ob der oder die Schuldige sich mit einem schlechten Gewissen quält oder im Gegenteil findet, er habe sich gar nichts vorzuwerfen. Etwa die Freundin, die gar nicht verstehen kann, warum ich übel nehme, wenn sie im Kollegenkreis privates von mir weitererzählt – Kündigungspläne, ein Erbschaftsstreit. So stehen lassen oder ansprechen? Mut gehört in jedem Fall dazu: Erst, sich dem eigenen Schmerz, der eigenen Enttäuschung zu stellen, erst recht aber, das Gespräch zu suchen. Tun oder lassen? Da hilft nur, die Risiken gegeneinander abzuwägen: Was ist besser zu ertragen, der ungeklärte Konflikt, oder dass es möglicherweise nochmal laut wird zwischen uns? Und bin ich bereit, die Perspektive zu wechseln und die andere Seite zu sehen?
Allerdings hat beides Grenzen, das Verzeihenkönnen ebenso wie die Versöhnung. Was für die eine gut abzuhaken ist, ist für die andere eine bittere Pille, die sich beim besten Willen nicht schlucken lässt – vom „like“ meiner Freundin für einen Beitrag aus einer politischen Richtung, die ich für gefährlich halte, bis zu dem nagenden Gefühl, dass die eigenen Eltern immer die Schwester, den Bruder vorgezogen haben. Oder wenn der Partner mit einer anderen schläft, obwohl man sich doch Treue versprochen hatte. Wo die Grenze des Verzeihbaren liegt, ist individuell, schließlich haben wir alle ein unterschiedlich dickes Fell. „Sicher ist: Wir werden alle mit Kränkungen sterben, die nicht verheilt sind“, sagt Melanie Wolfers. „Entscheidend ist, sich immer wieder auf den Weg zu machen. Nicht steckenzubleiben in der Opferrolle.“
Auch meine Bekannte Katja hat das so gemacht. Sie ist nicht mehr die Alte, nicht die Frau mit dem unerschütterlichen Vertrauen ins Leben, die sich unbeschwert auf die nächste Etappe freute. Aber auch das gehört zum Älterwerden, zum Wachstum, so sieht sie das heute: „Wir haben alle unsere Päckchen, die sich nicht einfach ablegen lassen. Dafür muss man innerlich Platz schaffen. Das ist jetzt ein Teil von mir, ich kann damit leben, ohne dass es mich beherrscht.“ Sie hat getrauert, weil der Mann, den sie geliebt hat, nicht mehr da ist. Es wohl schon lange nicht mehr war, ohne dass sie es wahrhaben wollte. Der Schmerz ist nicht völlig weg, aber sie hat dabei jemanden kennen gelernt. Eine neue Katja, die keine Lust mehr hat, einem anderen die Hosen zu waschen. Oder am Mittelmeer Urlaub zu machen, obwohl sie’s lieber kühler mag. Für diese neue Bekanntschaft nimmt sie sich jetzt viel Zeit.
Zum Weiterlesen:
Susanne Beyer, „Die Glücklichen – warum Frauen in der Lebensmitte so großartig sind“, Blessing, 22 € – 18 Porträts von Frauen zwischen Anfang 40 und Anfang 70, aus Kunst und Kultur, Mode und Sport, aber auch in bodenständigen Jobs und mit ungewöhnlichen Lebensentwürfen. Ein Blick auf das selbstbewusste Lebensgefühl einer neuen Frauengeneration
Melanie Wolfers, „Die Kraft des Vergebens“, Herder, Taschenbuch 14 € und „Freunde fürs Leben – die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein“, adeo, 16,99 €: Von einem zum anderen Buch spinnt die Bestsellerautorin ihre Gedanken zu Selbstliebe und der positiven Wirkung von Großherzigkeit gegenüber unseren Mitmenschen. Auch in ihrem Podcast „ganz schön mutig“ widmet sie sich immer wieder dem Thema Verzeihenkönnen (abzurufen unter melaniewolfers.de)
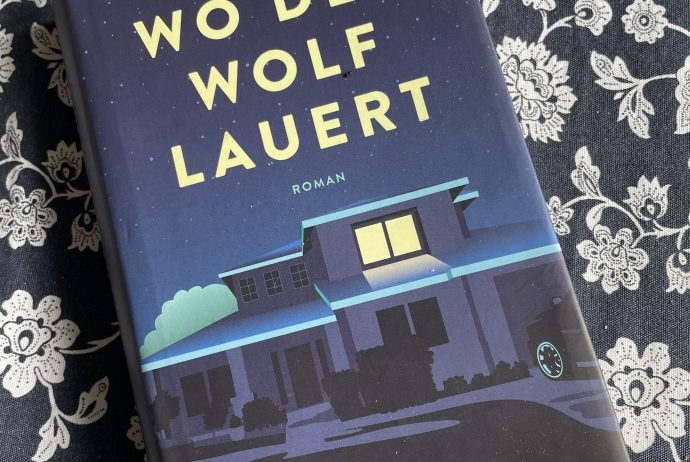
„Jede Mutter hält ihr Kind für ein unschuldiges Lamm – keine fragt sich, ob es der Wolf ist“
Was ist schlimmer für Eltern: Wenn das eigene Kind zum Opfer wird oder zum Täter? Und macht Liebe blind für die Schattenseiten derer, die uns nahe stehen? Die israelische Psychotherapeutin und Schriftstellerin Ayelet Gundar-Goshen stellt unbequeme Fragen – ich durfte sie für ZEIT online interviewen
Alle Eltern kennen die Angst, jemand könnte ihrem Kind etwas antun – von Ausgrenzung in der Schule bis zu Gewaltverbrechen. Für die Hauptfigur Ihres neuen Romans, eine israelische Mutter in Kalifornien, kippt diese Angst ins Gegenteil, als sie sich fragen muss, ob ihr Teenagersohn einen Mitschüler getötet hat. Was hat Sie an diesem Setting gereizt?
Als Autorin und Psychologin habe ich die Möglichkeit, Abgründe auszuloten, vor denen meine Figuren zurückscheuen. Aber auch persönliche Schlüsselmomente haben mich auf das Thema gebracht. Am ersten Kindergartentag meiner kleinen Tochter habe ich mich nervös gefragt: Was tun die anderen Kinder ihr möglicherweise an, wenn ich sie nicht mehr den ganzen Tag beschützen kann? Bis mir klar wurde: Mit mir stehen hier noch 20 andere Mütter, besorgt und mit Herzklopfen, in der Überzeugung, dass ihre eigenen Kinder unschuldige Lämmer sind, die in einen Wald voller Wölfe geschickt werden. Und keine fragt sich: Moment – könnte es sein, dass mein Kind selbst der Wolf ist?
Aber brauchen Kinder nicht auch diesen verklärten Blick, das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden?
Klar. Als Eltern sehen wir unsere Kinder im besten Licht, das ist unser Job. Wir nehmen an, dass niemand sie so lieben kann wie wir, mit Recht. Aber das bedeutet auch, dass wir blind sind für manche ihrer Seiten. Auch, weil es unser Selbstbild stört.
Das Kind als kostbarer Besitz, als Objekt elterlicher Allmachtsphantasien?
Manche präsentieren ihre Kinder wir einen Leistungsnachweis: das Beste, das mir je gelungen ist! Mich macht das misstrauisch. Wenn eine Mutter sagt: „Mein Kind würde nie etwas Böses tun“, dann ist das wichtigste Wort in diesem Satz das Possessivpronomen: „mein“. Etwas, das aus mir entstanden ist, ist über jeden Zweifel erhaben. Dieser Narzissmus bringt ein bestimmtes Selbstverständnis mit sich: ich mache mich zur Anwältin meines Kindes in seiner Auseinandersetzung mit der Welt, unabhängig davon, wer im Recht ist, egal, ob es um Schulnoten geht oder um Konflikte mit anderen Kindern.
Als die Mutter in Ihrem Roman herausfindet, dass ihr Sohn ein Verbrechen begangen haben könnte, will sie es nicht wahrhaben, verdrängt es, hat Angst, ihn zu konfrontieren. Mord ist natürlich ein extremes Beispiel, aber vielleicht verhalten sich die eigenen Kinder aggressiv, verbal oder körperlich. Was wäre Ihr Rat als Psychotherapeutin: Wie können wir mit unseren Kindern ins Gespräch kommen, damit sie lernen, besser mit solchen Impulsen umzugehen?
Mein Rat wäre: Nicht wegsehen, nicht kleinreden, sondern versuchen, die Motivation des Kindes zu verstehen. Verstehen heißt aber nicht akzeptieren. Wir müssen ganz klar machen, dass sein Verhalten falsch war, dass es bessere Wege der Konfliktlösung gibt, sollten aber Kinder nicht für ihr Verhalten bestrafen. Denn Strafe führt nur zu Groll und Wut, und wir möchten ja ein zarteres Gefühl auslösen – Bedauern. Deshalb sollten wir dem Kind vor allem vermitteln: Ich glaube, dass du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Du bist nicht böse, du hast etwas Böses getan, und du kannst es ändern.
Wahrscheinlich kommen viele Eltern gar nicht an diesen Punkt, weil sie so mit ihrer Angst beschäftigt sind, ihr Kind könnte selbst unter anderen leiden. Sie sagen, bei der Recherche für Ihren Roman haben ihnen einige erzählt: Wenn ich mich entscheiden müsste, ob mein Kind gemobbt wird oder andere mobbt, dann lieber zweiteres. Können Sie das nachvollziehen?
Ich hatte diese Diskussion sogar mit meinem eigenen Partner. Wie viele andere Eltern hat er gesagt: Natürlich möchte ich weder das eine noch das andere, aber im Zweifelsfall wünsche ich mir vor allem, dass mein Kind möglichst wenige Narben davonträgt, psychisch wie körperlich. Wenn es aggressiv ist gegen andere, kann ich es dazu bringen, sein Verhalten zu ändern, und es kann bereuen, was es getan hat – aber Opfer bleibt man ein Leben lang.
Ist das vielleicht eine spezifisch israelisch-jüdischen Erfahrung, eine Urangst: Alles, nur nie wieder Opfer sein?
Das dachte ich auch, als ich mich zuerst mit dem Thema beschäftigte. Der Holocaust ist unser kollektives Trauma, die Angst, wie Lämmer zur Schlachtbank geführt zu werden. Ich kann mich gut erinnern, als ich ein kleines Mädchen war und wir im ersten Golfkrieg einen Angriff aus dem Irak befürchteten, dass mein Großvater verbittert sagte: Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal erlebe, wie jüdische Kinder Angst haben müssen vor Gas. Er wäre lieber in den Krieg gezogen und sogar gestorben, als passiv in einem Schutzraum zu sitzen und nichts tun zu können. Aus diesem unerträglichen Gefühl von Hilflosigkeit erwächst eine Art israelische Macho-Mentalität: Lieber jetzt Stärke zeigen und es später bereuen als umgekehrt. Aber auch in anderen Ländern reagierten Eltern ähnlich auf meine Frage nach ihren Kindern, etwa in Deutschland oder der Schweiz. Ich glaube, es hat mit wachsendem Individualismus zu tun. Mit der globalen Feelgood-Diktatur.
Was meinen Sie damit?
Zufriedenheit und Selbstwertgefühl des Einzelnen stehen ganz oben auf der Agenda, über allem anderen, in weiten Teilen der Welt. Googeln Sie mal Artikel zum Thema „Wie stärke ich das Selbstbewusstsein meines Kindes“ und zum Thema „Wie erziehe ich mein Kind zu einem guten Menschen“ – jede Wette, dass sie beim ersten Begriff deutlich mehr finden?
Dabei spricht ja erstmal nicht dagegen, zu sagen: Hauptsache, meinem Kind geht es gut und es ist glücklich.
Vor zwei, drei Generationen noch ging es Eltern weniger um Wohlbefinden als um Moral, um Sinn, ständig beurteilten sie das Benehmen ihres Kindes: Wird aus ihm ein guter Christ, ein guter Kibuzznik, ein guter Kommunist? Natürlich ist es ein Segen, dass diese starren Systeme heute nicht mehr in der Form existieren, dass gesellschaftliche Zwänge und Schuldgefühle uns nicht mehr die Luft abschnüren. Aber manchmal scheint mir, wir haben das Konzept von Schuld komplett über Bord geworfen, und das besorgt mich. Als Konsequenz daraus biegen wir als Eltern die Welt so zurecht, dass unser Kind sich nicht wehtun kann, und übersehen dabei andere.
Macht es das Leben nicht auch aus, dass es nicht immer diese klaren Fronten gibt, hier Täter, da Opfer?
Genau da wird es interessant. Denn wenn wir uns ein neugeborenes Kind anschauen, und zu welcher Grausamkeit Menschen später im Leben fähig sind, dann fragen wir uns doch: Was ist schiefgelaufen auf dem Weg dahin? Niemand wird als Mörder geboren, als Nazi, als Faschist. Wenn wir uns nicht nur fragen, was unserem Kind geschehen könnte, sondern auch, wozu es fähig sein könnte, dass es Potenzial in sich trägt zu Gutem wie zu Bösen, wäre das ein großer erster Schritt, um Gewalt zu verhindern. Persönlich, zwischen Kindern, in der Schule, aber auch Gewalt zwischen Gruppen oder Nationen. Ich weiß noch, wie ich nach der Geburt meiner Tochter ihre winzigen Fingerchen betrachtete, und plötzlich so einen Gedanken hatte: Was wird sie damit alles tun, vielleicht schreiben, vielleicht Klavier spielen – oder den Abzug einer Waffe betätigen?
Aber warum ist es so schwer, sich den eigenen Abgründen zu stellen, und denen unserer Nächsten?
Weil uns die Vorstellung Sicherheit gibt: Das Böse ist irgendwo da draußen, hier drin, von mir und meiner Familie habe ich nichts zu befürchten. Wenn das Böse uns aber von außen bedroht, können wir es auch gemeinsam bekämpfen, können uns dabei auf der richtigen Seite fühlen, stark, wie in einem Thriller auf Netflix. Wenn wir merken, dass diese Sicherheit trügerisch ist, dann wird es dagegen unheimlich. Aber es wäre hilfreich, anzuerkennen: Das Monster ist nicht draußen, jenseits der Burgmauern, nicht hinter der Staatsgrenze, es ist nicht einmal in unserem Gegenüber, sondern in uns selbst. Deshalb ist es auch so wichtig, schon Kindern beizubringen, sich bei Konflikten in den anderen hineinzuversetzen: Wie würdest du dich fühlen, wenn das andere Kind dich ausgelacht oder gehauen hätte?
Heißt es auch, Verantwortung für unsere aggressiven Impulse zu übernehmen?
Verantwortung ist ein wichtiges Stichwort. In der Psychologie neigen wir manchmal dazu, vor lauter Verständnis für den Aggressor seine Taten zu rechtfertigen. Auf einer persönlichen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen. Nehmen wir den ersten Mord der biblischen Geschichte: Kain tötet seinen Bruder Abel, weil er so eifersüchtig ist, dass Gottvater dessen Opfergabe seiner vorgezogen hat…
…und deshalb ist Gott der wahre Schuldige in der Geschichte?
Eben nicht, das wäre zu einfach. Als Therapeutin würde ich zu Kain sagen: Ja, du hast ein Recht dazu, traurig und wütend zu sein, dich zu beklagen, weil Gott deinen Bruder vorzieht – aber das gibt dir noch nicht das Recht, ihn umzubringen. Und die Schuld dafür auf deinen Vater abzuwälzen. Das gilt genau so, wenn argumentiert wird: Oh, Hitler war so eine charismatische Persönlichkeit, klar, dass die Deutschen ihm gefolgt sind, sie konnten nicht anders. Diese Sichtweise ist fatalistisch, dann können wir auch gleich sagen: C’est la vie, das kulturelle Klima ist an allem Übel Schuld, das Bildungssystem, die Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir uns mit unseren eigenen negativen Gefühlen, Wut und Kränkungen auseinandersetzen, verstehen, woher sie kommen. Aber am Ende müssen wir uns an unseren Taten messen lassen.
Als israelische Mutter betrifft Sie unser Gesprächsthema auch ganz existenziell: Auch Ihr Sohn könnte eines Tages vor der Entscheidung stehen, entweder selbst zu töten oder getötet zu werden, in der Armee. Wie gehen Sie damit um?
Mein Sohn ist fünf, mit 18 wird er eingezogen, mir bleiben also nur noch 13 Jahre, in denen ich dazu beitragen kann, dass die Situation in Israel friedlicher wird. Damit sich keiner mehr entscheiden muss, Opfer oder Täter zu sein. Ich war immer sehr politisch engagiert, und Muttersein hat das noch verstärkt. Genauso hat mich meine Tochter noch mehr zur Feministin gemacht, weil ich alles durch diese Brille sehe: In was für eine Welt habe ich mein Mädchen gesetzt? Sie ist jetzt sieben, was kann ich tun, damit sie nicht später an der Uni oder im Arbeitsleben sexuell belästigt wird? Dass wir unsere Kinder als Erweiterung von uns selbst sehen, ist eben nicht nur narzisstisch, es hat auch eine positive Kraft. Man denkt intensiver über den Zustand der Welt nach und gibt sich nicht einfach mit dem Status Quo zufrieden. Im besten Fall dient das nicht nur den eigenen Kindern, sondern allen.
ZUR PERSON: Ayelet Gundar-Goshen, Jahrgang 1982, gehört zu den profiliertesten Stimmen in der jungen israelischen Literatur und gewann zahlreiche Preise. Sie lebt mit ihrer Familie in Tel Aviv, und arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin und Drehbuchautorin als Psychotherapeutin in einer Klinik. Ihr aktueller Roman „Wo der Wolf lauert“ erscheint in deutscher Übersetzung im Verlag Kein & Aber

Jetzt hängen sie wieder an der Nadel
Häkeln, Nähen und Co gelten nicht mehr nur als Hobby, sondern auch als Instrument der Selbstfürsorge. Und der Selbstdarstellung. Warum funktioniert die Masche bei mir nicht – und was für ein Frauenbild basteln wir uns da eigentlich? Das habe ich mich schon für mein aktuelles Sachbuch gefragt, das ich gerade mit Anne Otto veröffentlicht habe – und nochmal im Oktober 2021 für das „Sinnsuche“-Ressort auf ZEIT online
Auch in einer bis zum Anschlag polarisierten Welt gibt es immer mal wieder was, auf das sich alle einigen können. Na gut, vielleicht nicht alle, aber auch Menschen jenseits der eigenen Filterblase. So war das, als es plötzlich in größeren Städten mehr Yogastudios gab als Klempner, so ging es mir, als Leute anfingen, ihre Betonbalkons in grüne Wellnessoasen zu verwandeln (oder gleich aufs Land zu ziehen), und auch, als auf einmal ein Thema trendete, das zuletzt in meiner Kindheit populär war: stricken, häkeln, nähen. Meine Reaktion ist immer dieselbe: Erst Unglauben (Zopfmuster? Euer Ernst?), dann Trotz (Ihr habt doch einen an der Waffel!), gepaart mit Zerknirschung: Du bist ganz schön spät zur Party, meine Liebe. Schließlich Kapitulation: Probier’s halt wenigstens mal aus.
Jahre, ach was, jahrzehntelang waren die Frauen in meiner Umgebung clean, jetzt hängen sie wieder an der Nadel. Doch nun geht es nicht mehr wie in den Siebzigern und Achtzigern nur um eine nette Freizeitbeschäftigung, nein, es geht um alles: Etwas mit den Händen zu machen, so heißt es, steigere das Gefühl der Selbstwirksamkeit, gebe Bodenhaftung in einer entgrenzten, digitalisierten Welt. Erleuchtung, selbstgestrickt, gewissermaßen Yoga für die Finger.
Dass ich mir irgendwann einen Ruck gab, hatte mit der Suche nach Selbstfürsorge genauso zu tun wie mit Angst vor sozialer Ächtung. Natürlich kann man Jacken und Mützen auch weiterhin im gut sortierten Einzelhandel kaufen. Aber man fühlt sich dabei wie Cindy aus Marzahn, wenn sie beim veganen Schlemmerbüffet in Friedrichshain mit einer eingeschweißten Jägerwurst vom Discounter aufläuft. Irgendwie billig. Zum anderen ist das wollige Wohlgefühl mittlerweile gut erforscht, jenseits von Marketingumfragen à la „DIY-Verband: Stricken steigert Lebensglück um 27 Prozent!“ gibt es auch ernsthafte Studien zum Thema. So konnte die Psychologin Ann Futterman Collier von der Northern Arizona University vor einigen Jahren in einer Studie mit 435 Teilnehmerinnen nachweisen, dass Handarbeit langfristig und nachhaltig entspannt und erfrischt. Das Gewerkel soll den Stresspegel senken (messbar zum Beispiel über den Cortisolspiegel im Blut oder die Herzrate). Auch Patient:innen in psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken häkeln und stricken zu therapeutischen Zwecken. Die Wirkung ist ebenfalls evaluiert. Psychiatrieprofessorin Rebecca Jane Park von der Universität Oxford befragte Patient:innen mit Magersucht, die von der stimmungsaufhellenden Wirkung berichten und außerdem angaben, dass sie durchs Handarbeiten weniger grübelten und weniger sorgenvoll aufs Thema Essen fixiert waren. Carrie Barron, Professorin der Dell Medical School (University of Austin, Texas), vergleicht die Effekte der repetitiven Bewegungen gar mit denen der Meditation. Passend dazu hat sie an einem Buch mit dem Titel „The Creative Cure – how to build happiness with your own two hands“ geschrieben. Das Streben nach Glück, ein simples Strickmuster. Wer will sich das schon entgehen lassen.
Ich kaufte also Wolle, ein handschmeichelndes Bambus-Rundstrickset, und lud mir eine Anfänger-Anleitung für eine Beanie-Mütze aus dem Netz. Meine ersten Maschen seit 1978. Da war ich bei einem Strickversuch in der dritten Klasse krachend gescheitert. Ich habe heute noch das Geräusch im Ohr, mit dem die Lehrerin im Fach „Textiles Werken“ das Ding, das ein Schal werden wollte, bis auf die Grundfesten vernichtete. Nur, weil ich hier und da mal eine Masche hatte fallen lassen. Ein unbarmherziges „Rapp-rapp-rapp“, das sich mir bis heute ins Hirn gebrannt hat, als Gleichnis für die Vergeblichkeit menschlichen Strebens: Ihr, die ihr eintretet in den Werkraum der Grundschule Freiburg-Littenweiler, lasset alle Hoffnung fahren! Nun ließ ich mir per Youtube-Tutorial von einer schwäbelnden Frauenstimme Nachhilfe geben, wie ich den Faden zu führen hatte, und wartete auf das Wohlgefühl.
Um es vorwegzunehmen: Ich bin wieder gescheitert. Nicht etwa besser gescheitert, sondern abgrundtief. Diesmal nicht an einer unbarmherzigen Grundschullehrerin, sondern an meinen eigenen Minimalansprüchen. Vielleicht auch am inneren Widerstand. Schon beim Versuch, den Faden richtig zwischen den Fingern meiner linken Hand durchzufädeln, spürte ich, wie sich meine Stresshormone in gefährliche Höhen schraubten. Ganz ohne Labormessung. Ein Zustand zwischen renitenter Raserei, Selbstzweifeln, Trotz. Es wurde einfach nichts: mal zu fest, mal zu lose, und am Ende war ich hemmungslos verknäult im Hier und Jetzt. Nach Schulterstand und Balkonbepflanzung schon die dritte Challenge, bei der ich nicht mithalten kann. Bin ich wirklich zu blöd – oder habe ich mich selbst sabotiert?
Natürlich hat das eine ganz praktische Ebene. Die richtige Spannung zwischen Das-kann-ich-gut und Da-geht-noch-was, die zum Flow-Gefühl führt, setzt immer eine gewisse Grundfertigkeit voraus. Deshalb sucht man sich seine Herausforderungen auch passend zu seinen Begabungen. Geschicklichkeit ist jedenfalls nicht in meinen Top Three. Knopf annähen geht noch, jenseits wird es düster. Mit Handwerken habe ich es genau so wenig wie mit Handarbeiten, da bin ich ganz geschlechtergerecht. Mit 20 habe ich mal ein Jahr lang mit einem Kleiderschrank zusammengelebt, den ich selbst aufgebaut hatte. Weil ich die Bodenplatte falsch herum montiert hatte, war die Schiene für die Schiebetüren auf der falschen Seite, so dass ich die Türen nur lose in den Rahmen stellen und jedesmal per Hand herausnehmen musste, wenn ich mich umziehen wollte. Also etwa acht Mal am Tag (wie gesagt, ich war 20). Bis ein Freund sich erbarmte, das Ding auseinandernahm und neu zusammenbaute. Bye-bye, Self-Empowerment.
Aber ich glaube, es gibt noch tieferliegende Gründe, warum ich dem DIY-Trend so wenig abgewinnen kann wie diesem ganzen Neo-Biedermeier, wie Malbüchern und Marmeladekochen. Zum einen ist Muße auf eine verquere Art und Weise zu einem Statussymbol geworden, und Selbstgemachtes ist ihr sichtbarer Beweis, so wie früher die Ganzjahres-Gesichtsbräune. Nimm hin die selbstgestrickten Socken, liebe Schwester, beiß hinein ins krokodilförmig geschnitzte Gurkenstück, mein Kind, für dich habe ich stets genügend Zeit. Runterkommen, ja bitte, aber es soll auch etwas dabei rumkommen. Da möchte man allein aus Protest lieber völlig unproduktiv zwei Stunden lang Containerschiffe auf der Elbe anstarren. Oder den Inhalt des eigenen Weinglases.
Zum anderen hat das private Gestricke, Gebastel und Gewerke auch noch eine ungute politische Dimension. Wer die Hände beschäftigt hält und sich dazu noch komplexe Zopfmuster merken muss, kann nicht gleichzeitig lesen, denken, gar auf revolutionäre Ideen kommen. Nicht zufällig werden Stricknadeln in der Serie „The Handmaids‘ Tale“ (nach einem feministischen Roman aus den Achtzigern) immer wieder wie Waffen in Szene gesetzt. Das Gegenteil von entspannt, sondern eher ein Bild für die gedeckelte Wut von Frauen, die in einer dystopischen Zukunftswelt nicht mehr lesen, denken, arbeiten sollen. Sondern nur noch kochen, pflanzen und gebären. Reale Strickfreundinnen posten derweil auf Instagram und Pinterest Anleitungen für den roten Wollschal, den die fiktive Hauptfigur in der kalten Jahreszeit trägt. Sieht ja so cozy aus!
Und, a propos „Freundinnen“: Es gibt wenige Tätigkeiten, bei denen mir der Gender Gap so tief erscheint. Eher gehen Frauen in den Baumarkt als Männer in den Bastelladen. Vielleicht ist es das milde Licht der Erinnerung, aber waren wir nicht schon einmal weiter? Auf frühen „Grünen“-Parteitagen stricken wenigstens auch die Männer ihre eigenen Norwegerpullis, die Fotos kennt jeder. Und im Bekanntenkreis meiner Mutter gab es damals einen Psychotherapeuten, der Motive aus den Träumen seiner Patient:innen zu textilen Kunstwerken verarbeitete. An seinem Auto-Innenspiegel soll deshalb ein prächtiger Häkelpenis gehangen haben. Ziemlich gaga, völlig nutzlos und garantiert untauglich für DIY-Podcasts. So gesehen: Ganz nach meiner Mütze.

„Nur in scharf geschnittener Kleidung kann man scharf denken“
Finden wir nach der Pandemie wieder aus Jogginghose und Schlabbershirt heraus? Sicher, sagt Modetheoretikerin Barbara Vinken, und hat mir für die BRIGITTE im Oktober 2021 ein Interview gegeben. Aber unser Styling wird ein anderes sein. Das sieht man jetzt schon (auch an meiner Herbstgarderobe oben)
BRIGITTE: Optisch war Corona, insbesondere im Lockdown, die Epoche der Jogginghose, des Hoodies und des Ganztagspyjamas. Auch für Sie?
BARBARA VINKEN: Nein, denn ich bin überzeugt: Nur in scharf geschnittener Kleidung kann man auch scharf denken.Damit meine ich nicht einengend, es gibt wunderbare Alternativen – mein Schrank enthält viel Kaschmir, weite, Marlene-Dietrich-artige Writers‘ Pants, und schwingende Röcke und Kleider im Lagenlook.
Diese Wechselwirkung zwischen Outfit und Output haben im Homeoffice viele bemerkt. „Zieh dich richtig an, auch wenn dich keiner sieht“, habe ich selbst als Ratschlag verinnerlicht.
Unsere Geisteshaltung wird immer von unserer äußeren Haltung beeinflusst. Kleidung ist, linguistisch ausgedrückt, ein Sprechakt: Wir signalisieren damit, wer wir sind, selbst ohne dass jemand zusieht. Eine Jogginghose kann natürlich auch heißen: Pass auf, ich tue hier etwas so Ernsthaftes, ich habe keine Zeit für Oberflächlichkeiten. Auch das ist eine Form von Eitelkeit, ein Fetisch des Authentischen.
Sie glauben aber, man bringt darin trotzdem nichts Gutes zustande?
Jedenfalls ist man gleichzeitig sehr beschäftigt damit, nach außen zu signalisieren, wie unwichtig einem das Äußere ist.
Als Romanistin haben Sie den Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich: Hier das Land der Funktionsjacke, dort das Land des unangestrengten Alltags-Schick – hat sich das auch in der Pandemie modisch ausgewirkt?
Meinem Eindruck nach fühlten sich Menschen in Frankreich stärker eingesperrt und wahrten eher die Form, gerade wenn sonst alles Baden ging. Zogen sich zu Essen um, auch wenn sie nur zu zweit waren. Eigentlich ganz clever, es heißt ja nicht ohne Grund „There is always lipstick on a rainy day“. Lebensschönheit und Glück lassen sich manchmal auch über die äußere Form herstellen.
Manche prophezeien, dass wir uns auch nach Corona weiter leger kleiden werden. Die New York Times zeigte kürzlich Fotos von der Wall Street: Vor zwei Jahren sah man hier fast nur dunkle Anzüge und edle Lederschuhe. Jetzt sind auffallend viele Banker*innen in Sneakers, Jeans und bunten Sommerkleidern unterwegs.
Wie in vielen Lebensbereichen ist das Virus auch hier eher Beschleuniger, Katalysator, als Auslöser. Den Trend zu Streetwear, zur Abkehr von formellen Dresscodes, sehen wir seit mindestens zehn Jahren. Interessant ist, wie sich Frauen- und Männermode aufeinander zubewegt haben. Und die Frage, ob Corona die Richtung ändert.
Das müssen Sie erklären.
Die Frauenmode hat schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine gradlinige Entwicklung hinter sich, von der rein weiblich markierten Mode zur männlichen. Das Korsett fiel, der Bubikopf kam, die Hose setzte sich durch. Seit den 80er-Jahren schwankt Frauenmode zwischen zwei Polen. Mal eine fast aggressive Weiblichkeit mit Highheels und engen Röcken, die signalisiert: Jungs, passt mal auf, hier kommt eine Frau. Und mal einem Unisex-Stil, der eher signalisiert: Jungs, ich bin wie ihr. Die Männermode hat sich viel weniger geändert, doch in den letzten Jahren vor der Pandemie hat sich die Einbahnstraße zum ersten Mal umgekehrt. Auf den Laufstegen gab es auch Männer-Looks, die mit Durchsichtigkeit spielten, Ausschnitten, Rüschen, Codes für Weiblichkeit. Corona hat dieser zaghaften Fluidität fürs Erste ein Ende gemacht. Vielleicht, weil alle das Gefühl haben: Wir leben in ernsten Zeiten, da sind seriöse, kühle Macher gefragt.
Zumindest für Frauen sind die aktuellen Herbst- und Wintertrends wieder exaltiert und sexy – teilweise aber auch das Gegenteil: Minis, Lack und Metallic neben gefütterten Overalls, die fast wirken wie Labor-Schutzanzüge. Hat das auch noch mit der Pandemie zu tun?
Mode hat immer auch eine schützende Funktion, fast wie eine Rüstung. Nicht nur vor der Kälte, auch vor den Blicken der anderen. Ich denke, dieses Cocooning-Gefühl aus der Corona-Zeit wird bleiben, der Rückzug in warme, weiche Kleider, in die wir uns tröstlich einkuscheln könnten. Die andere Seite ist kein Widerspruch, das gehört dazu: Der Wunsch, den öffentlichen Raum zurückzuerobern, die Straßen, die Restaurants, und das Leben zu feiern, mit festlichen Stoffen und lauten Farben. So war es historisch gesehen fast immer nach Phasen von Seuchen, Kriegen, Katastrophen. Nach der Spanischen Grippe kamen in den 1920-ern Kleider mit Federn, Pailletten und Fransen, auf den Zweiten Weltkrieg folgte der „New Look“ mit schwingenden Röcken.
Das freut sicher die Modeindustrie, die hohe Verluste gemacht hat – laut einer McKinsey-Studie brachen die Umsätze 2020 um 15 bis 30 Prozent ein. Die höchsten Rückgänge gab es im Niedrigpreisbereich, stärker als in den gehobenen Segmenten. Geht der Trend auch langfristig weg von noch schneller, noch billiger?
Ja, und ich habe den Eindruck, viele in der Branche begrüßen das. Nach allem was ich höre, haben manche Modemacher das als Atempause gesehen, und sich gefragt: Brauchen wir ernsthaft sieben Kollektionen im Jahr, wollen wir wirklich weitermachen mit der massiven Ausbeutung von Umwelt und Arbeitskräften, mit Fast Fashion? Ich bin optimistisch, dass Corona unser Verhältnis zur Mode bewusster und nachhaltiger macht. Das aktuelle It-Piece ist auf jeden Fall ein Lieblingsstück, das vielleicht etwas teurer ist, aber gemeinsam mit uns älter wird, wie ein wertvoller Kunstgegenstand. Ich habe im Sommer ein Seidenkleid wiederentdeckt, sicher schon zehn Jahre alt, aber mit seinem Lagenlook wieder völlig passend zur Saison. Voilà!
Barbara Vinken, 61, ist Professorin für Romanistik an der Münchner LMU und macht immer wieder mit klugen Kommentaren zu ganz unterschiedlichen Themen von sich reden – sei es zur Mode, zum deutschen Mutterbild oder als Literaturkritikerin im Fernsehen.
„Wut ist eine Einladung, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen“
Schlechte Gefühle haben ein schlechtes Image – also versuchen wir sie wegzuatmen, wegzumeditieren, und suchen nach Harmonie um jeden Preis. Großer Fehler, findet Coach und Autorin Friederike von Aderkas: Wenn wir uns ärgern, steckt darin eine wichtige Botschaft und jede Menge Energie. Wir müssen nur lernen, sie klug umzusetzen (mein Interview stammt aus einem Brigitte-Dossier unter dem Motto „Los-Lassen“, veröffentlicht im Spätsommer 2021)
Was haben Greta Thunberg, Seenotretterin Carola Rackete und Schauspielerin und MeToo-Initiatorin Alyssa Milano gemeinsam? So unterschiedlich ihre Anliegen sind – den Klimawandel bekämpfen, unmenschliche Migrationspolitik oder toxische Männlichkeit – , ihr Treibstoff ist derselbe. Drei Wutbürgerinnen im allerbesten Sinne, die zu Role Models geworden sind. Weibliche Wut ist Talkshowthema, Bestsellertitel, Trendthema. Aber tut Wut wirklich gut? „Klar, sie kann auch zerstörerisch, gewalttätig und verletzend sein, aber das ist nur ihre Schattenseite. Wenn ich sie spüre, steckt darin zuerst eine Information: Hier stimmt etwas nicht für mich. Und diese Lebensenergie lädt mich ein, für meine Bedürfnisse einzustehen“, sagt Friederike von Aderkas, Pädagogin und systemischer Coach, die auch Seminare zum Thema gibt. Ihr aktuelles Buch* ist eine Ehrenrettung für jene Emotion, die wir häufig verdrängen, abspalten, die uns unheimlich ist. Mit schwerwiegenden Folgen, sagt von Aderkas: Sie ist überzeugt, dass sowohl körperliche Symptome wie Verspannungen, Kopfschmerzen und Auto-Immunkrankheiten als auch Depressionen häufig mit unterdrückter Wut zu tun haben. „Sie gibt uns eine Richtung vor. Wenn ich mich stattdessen wie mit angezogener Handbremse durchs Leben bewege, werde ich gedämpft und lethargisch.“ Aber wie geht das, die Handbremse lösen? Fünf Situationen, fünf Tipps von der Expertin.
Im Job: Kurz vor Feierabend knallt Ihnen die Kollegin einen Stapel Vorgänge auf den Schreibtisch: „Sorry, die Kita schließt in einer halben Stunde und das muss heute noch raus. Könntest du so lieb sein?“ Kein einmaliger Notfall, so geht das schon seit Monaten.
Was meistens passiert: Fast in jedem Team gibt es die eine, die für alle die Kohlen aus dem Feuer holt. Vielleicht, weil sie als Kinderlose vermeintlich weniger private Aufgaben hat, oder weil sie als besonders effizient gilt. Sie sind das? Dann wissen Sie ja, wie sich das anfühlt. Sie ballen die Faust in der Tasche und schweigen. Vielleicht laden Sie Ihren Frust beim Partner ab, aber wehren sich nicht, schließlich brauchen Sie den Job noch. Vielleicht gefallen Sie sich auch in der Rolle als „verantwortungsvolles Opfer“, als stille Heldin. Schlimmstenfalls bis zum Burnout.
Was besser wäre: Beim nächsten Mal Stellung beziehen und sich abgrenzen: „Ich sehe deine Not, aber mir wird es gerade auch zu viel. Lass uns das ins nächste Teammeeting einbringen, ich unterstütze dich gern.“ Das ist solidarisch und gibt den Druck dorthin zurück, wo er entsteht – nach oben. Aber bitte nicht gleich voller Aktionismus voranmarschieren („Ich formuliere schon mal eine Mail an die Chefin!“), denn auch die permanente Retter-Rolle tut nicht gut.
Im Alltag: Der neue Drucker steht, hat Papier, den richtigen Treiber, und ist ans W-LAN angeschlossen. Er blinkt freundlich. Was er nicht tut: drucken. Und das, obwohl wir in zwei Stunden ein Papierdokument brauchen.
Was wir häufig tun: Wenn Technik unsere Pläne durchkreuzt, macht uns das hilflos – und wütend. Typische Reaktionen: meckern (laut oder leise), jammern (bis jemand aufmerksam wird, der Partner, die Kollegin), aggressive Selbstbefragung: Wer spinnt, der neue Drucker/Staubsauger/das Internet, oder ich? Bei etwas robusteren Geräten auch: Draufhauen. Bringt in den seltensten Fällen eine Lösung, klar.
Was wir lieber tun sollten: Uns fragen, woher die Wut kommt (zweifle ich an mir und meinen Fähigkeiten?) und gegen wen sie sich richtet: den Hersteller, die Verkäuferin im Elektronikmarkt, mich selbst? Verstehen, was uns so aufregt, überlegen, wer uns helfen kann, unser Nachbar, der Kundendienst, das Handbuch. So bringt Ärger uns in Aktion, ohne dass etwas zu Bruch geht.
In der Liebe: „Wollen wir nicht am Sonntag in diese neue Fotokunstausstellung?“, hat sie gefragt, und er hat irgendwie zustimmend gebrummelt. Am Sonntag sieht sie ihm fassungslos zu, wie er sein Rennrad aus der Garage holt: Und ihr schöner Vorschlag?
Plan A, leider typisch: Weil wir in der Liebe besonders verletzlich sind, sprechen wir häufig in verschlüsselten Botschaften. Ein Verhalten, das wir oft schon als Kinder eingeübt haben, um Konflikte mit den Eltern zu vermeiden. Kommt die Message nicht so an, wie wir es gerne hätten, nörgeln wir danach oft anlasslos an unserem Partner herum, oder schmollen („Ob was los ist mit mir? Nein, wieso?“)
Plan B, leider selten: Klare Kommunikation macht den Kanal zwischen den Beteiligten frei – vorausgesetzt, es handelt sich wirklich um einen Vorschlag und nicht um eine Forderung (die eigentlich lauten müsste: „Ich will ins Museum, und wehe, du sagst nein!“). Wer Verantwortung übernimmt für das, was er oder sie in der Partnerschaft will, ob beim Sonntagsausflug, in der Lebensplanung oder im Bett, legt die Karten auf den Tisch und bereitet den Weg: zu Einigkeit, zu einem Kompromiss, oder auch zu getrennten Wegen hier und da. Das kann auch mal wehtun, ist aber ehrlich.
In Freundschaften: Wenn Sie die Nummer Ihrer Freundin auf dem Display sehen, ist fast immer Not am Mann. Beziehungsprobleme, die schwierige Mutter, Der Job. Allmählich fühlen Sie sich wie Alexa, nur aus Fleisch und Blut: Egal, was Sie sagen oder wie es Ihnen geht, Ihre Freundin redet, Sie hören zu und versuchen zu helfen. Nervt.
Beim nächsten Mal: Vielleicht werden Sie irgendwann laut: „Merkst du eigentlich, dass ich nur dein Seelenmüllplatz bin?“ Vielleicht gefallen Sie sich in der Rolle der Heiligen: Die Arme, sie hat es ja auch schwer. Oder Sie greifen zu Zynismus. „Oh, hallo, da ist ja das Traumpaar!“, wenn Sie sie innig mit dem Typen im Straßencafé sehen, über den sie sich gestern noch bitter beklagt hat.
Beim übernächsten Mal: Klartext reden: Ich fühle mich nicht gesehen, ich wünsche mir unsere Freundschaft anders, fällt dir eigentlich auf, wie sich die Gespräche im Kreis drehen? Gut möglich, dass die Aussprache die Freundschaft entgiftet, sie hat ja kaum aus Berechnung so gehandelt. Übrigens: Kann es sein, dass auch sie ein verkorkstes Verhältnis zu Wut hat, wenn sie lieber mit Ihnen über ihren Partner, ihre Mutter oder ihren Chef lästert, als denen gleich reinen Wein einzuschenken?
In der Politik: Sie sind der Souverän, schließlich leben wir in einer Demokratie. Praktisch fühlen Sie sich aber nicht so: ob Kohleausstieg, Maskenpflicht oder Vermögenssteuer, ständig werden Entscheidungen getroffen, die Sie sauer machen.
Wohin mit der Wut? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich Luft zu machen: eine Fülle von Social Networks, Freund*innen, Kolleg*innen. Problem: Wir fühlen uns danach häufig nicht besser. Wut mobilisiert Energie, sie kommt aber nirgends an.
Wohin mit der Wut – aber richtig? Erstmal schauen, woher das Gefühl kommt: Habe ich generell ein Problem mit Autorität, oder geht es wirklich um Sachfragen? Dann weitersehen: Inwieweit betrifft mich das Problem, und was beendet das Gefühl der Ohnmacht? Ich kann mich einer Initiative anschließen, Unterschriften sammeln, mich an meine*n Abgeordnete*n wenden. Aber auch beschließen: Nicht mein Zirkus, das sind nicht meine Affen, ich bleibe lieber als Beobachterin im Energiesparmodus. Keine Feigheit, sondern auch mal gesunder Selbstschutz.
*“Wutkraft – Energie gewinnen, Beziehungen beleben, Grenzen setzen“, Beltz, 17,95 €
Mittlere Reife
Sind wir nicht alle unvergleichlich – und deshalb auch unvergleichlich schön? Ich musste ganz schön alt werden, um das zu kapieren. Dann habe ich mir vor lauter Freude darüber erst einen Bikini gekauft, dann für die BARBARA darüber geschrieben (Oktoberheft 2021)
Vor Jahren hatte ich einmal beinahe ein Schlüsselerlebnis. Da war ich innerhalb einer Woche erst bei einer Modedesignerin und ihrem Team zu Gast, eines Interviews wegen, und dann mit einer Freundin in einem Schwimmbad in Süddeutschland. Eben im Pariser Atelier noch Rhinozeros unter Elfen, jetzt Poolnudel unter Bojen. Ein Jojo-Effekt ohne jede Gewichtsschwankung. Mit einem After-Two-Babys-Body in Größe 42 bei knapp Einssiebzig hängt das Selbstbild eben stark davon ab, wer noch mit im Bild ist.
In dem Moment hätte eigentlich der Groschen fallen sollen: Wenn Schönheit so relativ ist, kann ich mich dann nicht einfach gut finden, und alle anderen auch, egal ob XL oder Size Zero? Die ganze Fülle des Lebens? Aber statt meinen inneren Kritiker gefesselt und geknebelt über Bord zu werfen, fand ich weiterhin, ich könnte meinen Anblick in einem Bikini jetzt echt niemandem mehr zumuten. Nicht mal meinem eigenen Spiegel. Ich trug damals jahrelang brav Badeanzug in gedeckten Farben, oberarmverhüllende Shirts, zeltartige Mäntel. Schluss mit lustig. Ich Dummerle dachte, das muss so. Aber ich war auch erst Ende 30, also praktisch ein halbes Kind.
Und dann kam der Tag im Sommer 2021, als ich feststellte: Ich bin 51, also endlich alt genug, mir wieder einen Zweiteiler zu kaufen. Einfach, weil ich Lust darauf habe. Obwohl ich in Zwischenzeit weder schöner noch dünner geworden bin, und außerhalb jeder Konkurrenz um die Miss Beachbody laufe. Oder vielleicht gerade deswegen? Unter Umkleidekabinenoberlicht, mit FFP2-Maske im Gesicht und Coronaspeck auf den Schenkeln, entdeckte ich die Leichtigkeit des Loslassens. Und das lang vermisste Gefühl von Freiheit, wenn Luft an den Bauchnabel kommt. Mit über zehn Jahren Verspätung fiel der Groschen. Sofort buchte ich einen Slot im Freibad. Erst nach dem Schwimmen fiel mir auf, was fehlte. Ich hatte nicht ein Mal kritisch meine Silhouette beäugt, wenn ich an spiegelnden Glasscheiben vorbeilief. So wie mit 15, 25, 35. Ob sonst jemand geguckt hat, und wie? Egal. Vielleicht waren Blicke einmal eine gültige Währung. Aber das waren auch Lire, Gulden und Peseten. Was heute mehr Wert hat: Wohlfühlen mit mir selbst.
Der Sommer war groß und ist vorbei, der neue Bikini noch da, die Freude am Älterwerden auch. Klar pushen auch Buzzwords wie „Body Positivity“ mein neues Selbstbewusstsein – wenn auf Instagram auch Körperformen Applaus bekommen, die nicht nach Diätmargarinewerbung aus den Neunzigern aussehen, fühle ich mich sichtbar in besserer Gesellschaft. Aber das gute Gefühl geht tiefer als der kurvenfreundliche Zeitgeist. Ein Teil davon ist pandemiebedingt: Wenn ein Virus Gesundheit und Leben bedroht, wird erst klar, wie dankbar man sein kann für einen Körper, der treu seinen Dienst tut. Der atmet und stoffwechselt und dabei seinen wichtigsten Teil spazieren trägt, den eigenen Kopf mit den eigenen Gedanken. Auch wenn er dabei nicht immer bella figura macht. Ein anderer Teil ist corona-unabhängig: Ich achte besser auf meine Energiebilanz. Denn Energie verschwendet, das habe ich in den letzten Jahrzehnten mehr als genug. Mit erfolglosen Versuchen, mich in eine Form zu zwängen, die mir nicht entspricht. Oder damit, mich darüber zu grämen. Stattdessen gehe ich mit 70 Kilo Leichtigkeit durchs Leben. Und nicht mehr mit untertänigem Gefühl shoppen („Ist mein armseliger Körper gut genug für diesen und jenen Schnitt, diese oder jene Länge?“), sondern mit einer königlichen Attitüde: „Na, ihr Wichte, seid ihr schön genug für mich?“ Manchmal guckt jemand, und ich habe eine Ahnung, was Leute in mir sehen. Eine Frau, die in sich selbst zu Hause ist und mit ihrem unperfekten Aussehen im Reinen. Was wir alle sein sollten, jederzeit, nicht erst mit 51. Das wäre ein Glück.



