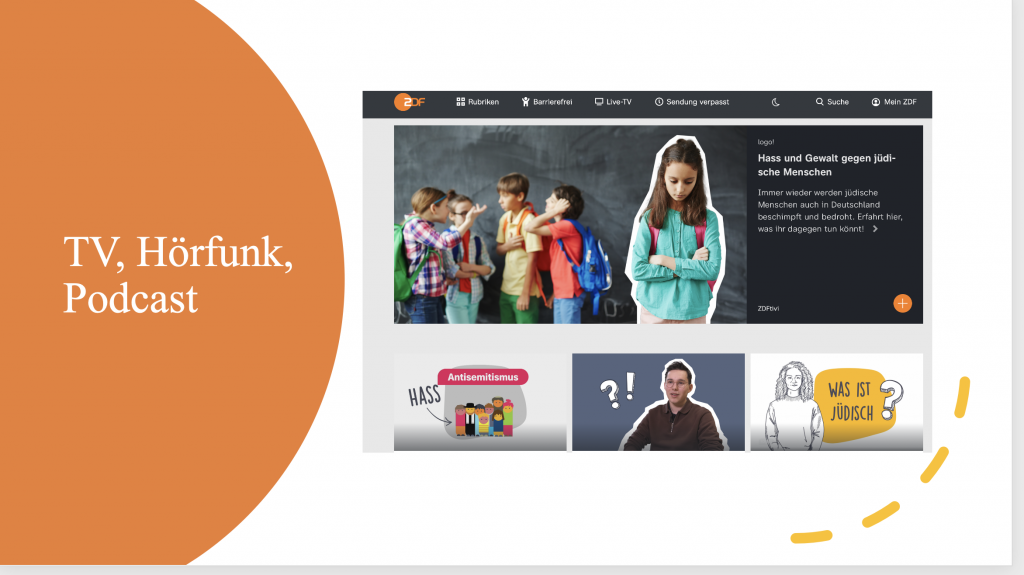Von Käse und Korrelationskoeffizienten: Warum ein Studium mit 50+ lang vergessene Wissensschnipsel überraschende Volten schlagen lässt
Damals, in der WG, haben wir uns mal etwa drei Monate fast ausschließlich von Gorgonzolanudeln ernährt.
Nicht, weil wir so scharf darauf waren, sondern wegen des Überangebots im Kühlschrank. Und das wiederum hatte mit meinem Studentenjob zu tun.
Ich arbeitete tageweise für ein Marktforschungsinstitut, das Leute in sein Studio am Sendlinger Tor in München zerrte, um sie dort Lebensmittel testen zu lassen, bevorzugt Milchprodukte, also Joghurt, Quark, Käse Co. Die Leute bekamen dann zum Beispiel zwei Sorten Fruchtquark und ein kleines Löffelchen hingelegt und mussten auf einer Skala von eins bis zehn angeben, wie leicht, frisch oder gesund sie die Probierhäppchen einschätzten. Ob der Salzgehalt zu niedrig, zu hoch oder gerade richtig war, und ob sie das Produkt „auch Kindern geben“ würden (aus irgend einem Grund die Lieblingsfrage des Instituts, sie kam immer, außer bei Sekt).
Das trugen wir dann in Fragebögen ein, zusammen mit den soziodemographischen Angaben, und da wurde es regelmäßig interessant. Denn wichtig an unserem Job, das schärfte uns die Chefin ständig ein, waren die korrekten Quoten der Testpersonen. Also etwa: Frauen, Männer, Altersgruppen, Bildungshintergrund.

Waren junge Frauen gefragt, war es ganz einfach. Dann schickten wir einen Kollegen zum „Baggern“ auf die Straße, einen extrem gut aussehenden Typen mit iranischen Wurzeln, der eigentlich gar nichts tun musste außer Lächeln. Dann waren Frauen gleich welchen Alters und Bildungsabschlusses in der Regel bereit, mit ins Studio zu kommen und auch die absurdesten Fragen zur Leichtigkeit von Dessertcremes zu beantworten.
Fehlten hingegen Männer über 60 mit mittlerem Schulabschluss, war unsere Wunderwaffe wirkungslos. Die winkten meist ab und murmelten etwas unverständliches auf bayerisch. Wenn alles nichts half, behalfen wir uns mit fiesen Tricks: Wir erfanden Testpersonen und füllten die Fragebogen einfach selbst aus.
Und damit das nicht auffiel, mussten halt auch die zu testenden Lebensmittel verschwinden. So waren die Kühlschränke unserer WGs regelmäßig randvoll mit Milchprodukten aller Art. Besonders lustig war das Fragebogen-Selbstausfüllen, glaube ich, beim Sekt-Test – da haben wir uns gleich zwei, drei Fläschchen aufgemacht, um unsere Kreativität anzuregen.
Wir waren der Relotius unter den Marktforschungs-Jobber:innen.
Warum mir neulich diese fast vergessene (und legal mit Sicherheit verjährte) Anekdote aus den frühen Neunzigern einfiel? Nun: Studierendenjobs brauche ich in meinem neuen Masterstudium an der HMS keine mehr, ist ja berufsbegleitend. Aber beim letzten Seminar zum Thema quantitative Sozialforschung (oben und unten im Bild: unsere Dozentin Anna Freytag) stellt ich erstaunt fest, was alles so auf meinem mentalen Dachboden herumlag und eigentlich noch gut war. Skalierte Fragen? Da war doch was? Ja, klar, so sollten doch früher schon die Testpersonen die Leichtigkeit von Fruchtquark einschätzen.
Und mein erstes Studium, was mit BWL? Offenbar auch nicht ganz umsonst: Da habe ich mal Statistik gelernt. Ich hatte von daher zumindest eine vage Ahnung von Normalverteilung, Standardabweichungen und Korrelationskoeffizienten, stellte ich fest. Nicht mehr ganz frisch, aber als Begriff auch nicht ganz neu. Immerhin: Das hieß 1991 schon so, auch vor Erfindung der digitalen Welt für alle.
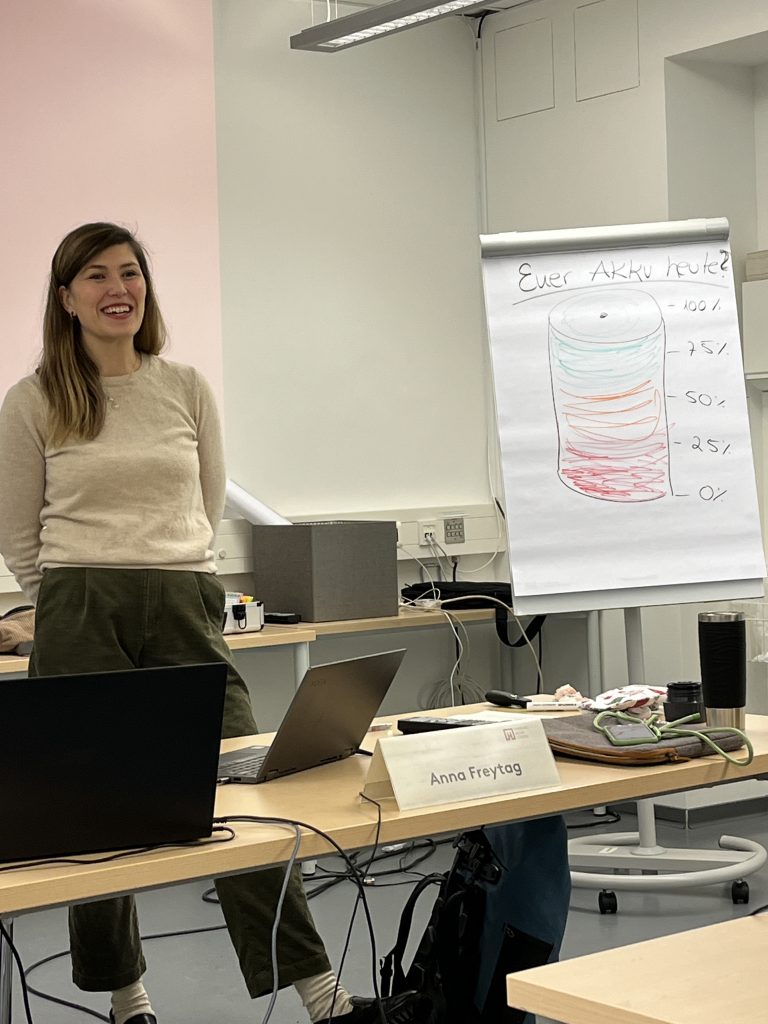
Je länger ich dabei bin, desto mehr stelle ich fest: Auch wenn ich in vieler Hinsicht – vor allem digitale Tools – anderen Studierenden hinterherhinke, immer wieder fügen sich alte und neue Puzzleteilchen zusammen wie beim Tetrisspielen. Ein gutes Gefühl. Die Teilchen setzen sich aus vielen verschiedenen Töpfen zusammen: Vor allem fast 30 Jahre Berufserfahrung, aber auch vergessen geglaubtes Wissen aus allen möglichen Bereichen – etwa diesem absurden Produkttester-Nebenjob, mit dem ich mir 1991 das absurd teure Münchner Nachtleben finanzierte.
Man ist vielleicht nicht mehr so richtig nah dran an Theorien, Tools und Lernmethoden wie diejenigen, die gerade erst ihr Bachelor-Studium hinter sich gebracht haben. Aber dafür sitzt man in einer gut gefüllten mentalen Vorratskammer und bringt manchmal erstaunliche Assoziationsketten zum Leuchten.
Oder, wie es mir in einem Interview einmal die Bildungsforscherin Elsbeth Stern so schön auf den Punkt gebracht hat: Alles Lernen ist Verknüpfen! Da ist es manchmal gar nicht verkehrt, ein paar Knotenpunkte mehr zu haben. Der Spruch „Nichts im Leben passiert ohne Grund“ bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Und was gut ist, kommt wieder. Ich kann mittlerweile sogar wieder Nudeln mit Gorgonzolasauce sehen, ohne dass mir schlecht wird. Es hat aber ungefähr 20 Jahre gedauert.
Vielleicht kann ich sie sogar irgendwann wieder essen.